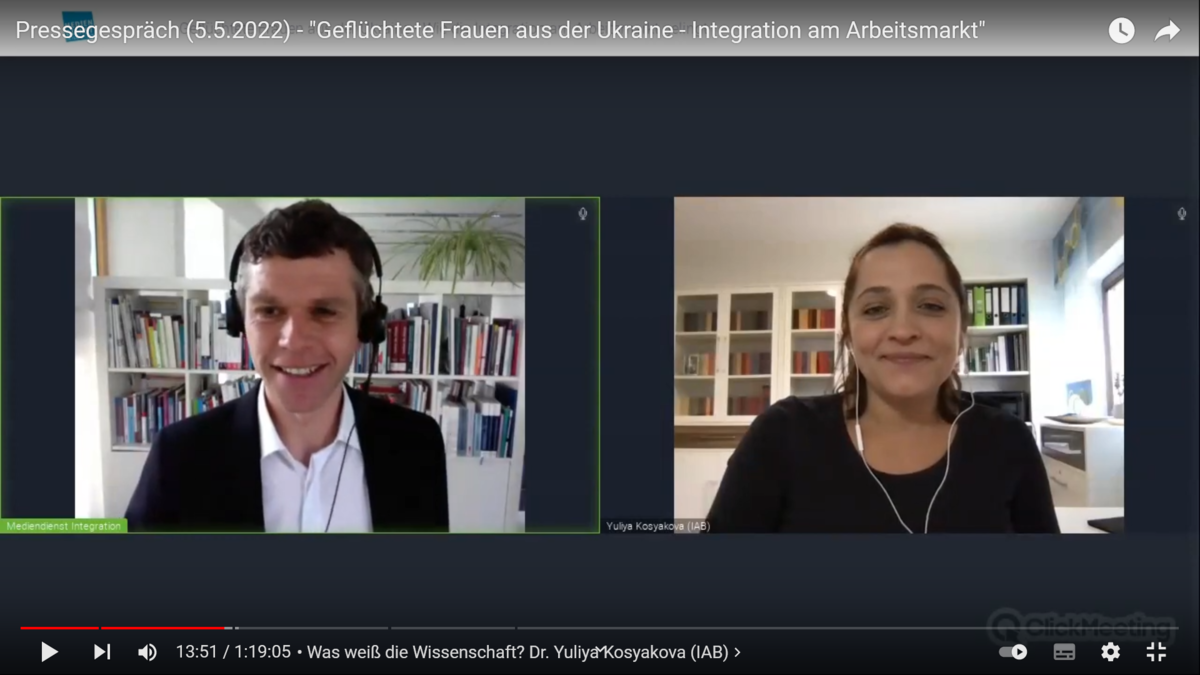MEDIENDIENST Integration: Sie sind vor zwei Jahren vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen. Wie hat sich Ihr Leben seit Ihrer Ankunft im Frühjahr 2022 in Berlin verändert?
Valeriia Semeniuk: Seitdem hat sich fast alles geändert. Mein Leben heute ist ein anderes. Als ich vor zwei Jahren mit meinen beiden Kindern nach Deutschland kam, war das eine sehr schwierige Zeit. Am Anfang waren wir sehr traumatisiert, wir waren gestresst, wir waren im Schockzustand. Kein Mensch kann einen solchen Zustand lange aushalten. Deshalb haben wir versucht, den Schmerz zu dämpfen, und jetzt geht es uns schon besser.
Was hat Ihnen geholfen, in Deutschland anzukommen?
Mein Leben und mein Fall sind, glaube ich, eine Ausnahme. Natürlich hat mir sehr geholfen, dass ich eine Arbeit bekommen habe und so sogar in meinem Beruf bleiben konnte. Denn ich habe an einem Programm vom Tagesspiegel für geflüchtete Journalisten teilgenommen. Ich habe nicht geglaubt, dass es möglich ist, ohne gute Deutschkenntnisse in Deutschland als Journalistin zu arbeiten. Und um ehrlich zu sein, bin ich damals davon ausgegangen, dass ich eine nicht-qualifizierte Tätigkeit ausüben muss. Ich war bereit, als Reinigungskraft zu arbeiten.

Valeriia Semeniuk ist eine ukrainische Journalistin. Im Februar 2022 floh sie gemeinsam mit ihren zwei Kindern aus Kyjiw nach Deutschland - ihr Mann blieb in der Ukraine. Seit Mai 2022 arbeitet sie aus Berlin als Journalistin, unter anderem für den Tagesspiegel.
Sie und Ihre beiden Kinder haben in der Ukraine schon Deutsch gelernt, bevor Sie nach Berlin gekommen sind. Wie wichtig war das?
Es hat auf jeden Fall geholfen. Ich war sehr froh, dass ich schon Deutschkenntnisse hatte. Denn in meinem Alter eine ganz neue Sprache zu lernen, ist nicht einfach. Mein Sohn zum Beispiel hat schon vor dem Krieg darüber nachgedacht, ob er nicht in Deutschland studieren soll. Er hat jetzt begonnen, an der Uni in Freiburg zu studieren. Auch meine Tochter hat in der Ukraine Deutsch gelernt, aber erst seit zwei oder drei Jahren. Ihre Vorkenntnisse waren deshalb nicht so groß.
War es für Ihre Kinder einfacher als für Sie, in Deutschland neu anzufangen?
Ich würde nicht sagen, dass sie sich besser als ich in Deutschland integriert haben. Überraschenderweise. Man vermutet ja, dass Kinder sich einfacher integrieren. Grundsätzlich. Ich weiß nicht warum, aber sie leiden mehr unter Einsamkeit als ich. Ich habe am Anfang auch gelitten. Die Deutschen wirkten auf mich verschlossen, zurückhaltend, kühl. Aber mit der Zeit hat sich das geändert.
Im Frühjahr 2022 kamen viele Personen an den Berliner Hauptbahnhof, um Menschen aus der Ukraine, die Hilfe brauchten, zu unterstützen. Haben Sie das Gefühl, dass sich diese Solidarität seitdem verändert hat?
Ich glaube, es ist nicht richtig, die Situation von damals mit der von heute zu vergleichen – grundsätzlich. Denn natürlich ist es nicht möglich, ein solches Maß an Solidarität über zwei Jahre aufrechtzuerhalten. Ich erwarte das auch nicht. Wir müssen uns selbst irgendwie unser Leben aufbauen.
Fühlen Sie sich in Deutschland willkommen?
Ja, absolut! Besser als ich am Anfang erwartet habe. Ich glaube, je länger ich hier bin, desto schwieriger ist der Gedanke, eines Tages zurückzufahren. Ich bin hier zwar nicht heimisch. Ich fühle mich fremd, ich bin Ausländerin. Aber in der Ukraine sagt man: Die Zeit heilt und ich glaube, das ist das Wichtigste für alle. Wir haben uns an das Leben hier gewöhnt und es läuft nicht so schwierig wie im Vergleich zum Anfang.
Sie haben in einem Artikel geschrieben, dass der russische Präsident Wladimir Putin die Ukraine vereint habe. Wie meinten Sie das?
Vor dem Krieg war unsere, die ukrainische Gemeinschaft, nicht sehr einheitlich. Es gab einen Teil der Menschen, die freundlich gegenüber der - ich nenne es mal russischen Welt – eingestellt waren. Das ist jetzt anders. Putin hat uns geeint.
In einem Ihrer Artikel haben Sie Schuldgefühle bei sich und in der ukrainischen Community in Deutschland angesprochen.
Am Anfang empfand ich dieses Gefühl sehr stark. Doch ich war nicht allein – vielen von uns ging es so. Es geht um den sogenannten Schuldkomplex der Überlebenden. Es war uns peinlich, in Deutschland das Leben zu genießen. Um es überspitzt zu sagen: Wie können wir uns hier eine Maniküre machen lassen, während unsere Kolleginnen und Freundinnen mitten im Krieg sind und leiden?
Hat sich das Gefühl mit der Zeit verändert?
Ja, das Gefühl hat sich mit der Zeit verändert und ich glaube, es ist kein Schuldgefühl mehr, sondern ein Fluchtgefühl. Denn ich merke, wie ich mich an das Leben in Deutschland gewöhne. Ich fühle mich hier zwar immer noch fremd, aber gleichzeitig, wenn ich ab und zu in die Ukraine zurückfahre, fühle ich mich auch da ein bisschen fremd.
Fahren Sie oft in die Ukraine?
Meine Tochter und ich reisen ab und zu in die Ukraine – vielleicht vier Mal im Jahr. Mein Sohn ist jetzt 19 Jahre alt und gilt deshalb als wehrpflichtig. Er kann nicht zurückfahren, um seinen Vater zu sehen. Ich kann verstehen, dass diese Reise in den Krieg für Deutsche ein wenig seltsam aussieht. Sie verstehen, dass wir zumindest für einen kurzen Urlaub zurückkehren möchten. Aber zugleich stellen sie sich die Frage: „Warum fahren sie in die Ukraine, während Krieg ist?“. Die Antwort ist ganz einfach: Weil es unser Heimatland ist. Und viele von uns sind bereit, Risiken einzugehen, um dorthin zurückzukehren, wenn auch nur für ein paar Tage.
Interview: Lina Steiner
Sie sind Journalist*in und haben weitere Fragen oder suchen Fachleute zum Thema? Dann können Sie uns gern kontaktieren. Wir helfen schnell und unkompliziert. Unsere Texte und Grafiken können kostenfrei unter den Regeln der Creative Commons und unserer Namensnennung verwendet werden. Dies gilt nicht für Bilder und Fotos, die wir von Dritten erworben haben.