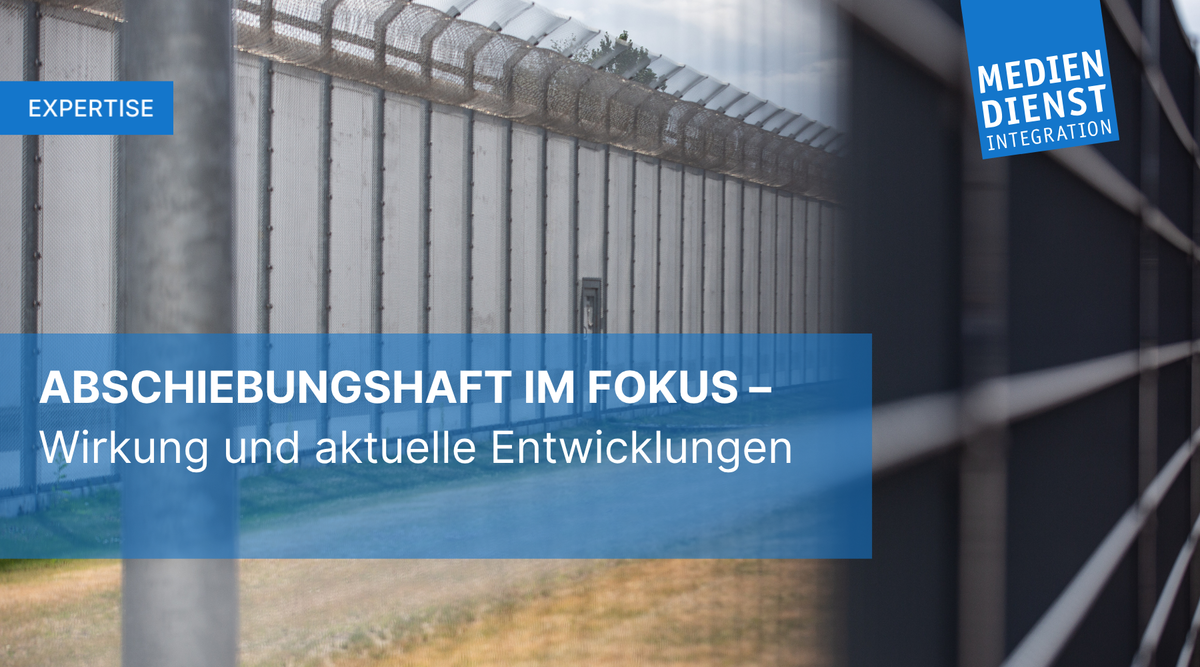Schade, diese Seite können wir leider gerade nicht bieten.
Haben Sie sich vielleicht vertippt?
Ansonsten finden Sie hier mehr...
Mehr ausreisepflichtige Menschen werden inhaftiert
Die Bundesregierung will die Zahl der Abschiebungen erhöhen. Dafür will sie unter anderem die Möglichkeiten, ausreisepflichtige Ausländer in Haft zu nehmen, abermals erweitern. Was haben bisherige Reformen gebracht? Mehr ...
Mehr Männer flüchten nach Deutschland
Zum ersten Mal wurden im September mehr neu angekommene ukrainische Männer als Flüchtlinge registriert als Frauen. Die Gesamtzahl der Neuregistrierungen ist im Vergleich zum Vorjahr um 37 Prozent gesunken. Mehr ...
THEMEN A-Z
Sie suchen nach Zahlen und Fakten? Hier finden Sie unsere Themen von A-Z. Nutzen Sie die übersichtliche Suche nach Schlagworten. Mehr ...MDI-HIGHLIGHTS
10 Jahre "Wir schaffen das"
Vor knapp zehn Jahren sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel den berühmten Satz „Wir schaffen das“ in Bezug auf die Aufnahme und Integration von Geflüchteten. Was wurde in den vergangenen zehn Jahren geschafft? Und was nicht? Eine Übersicht. Mehr ...
Polizei und Rassismus
Racial Profiling, rassistische Chatgruppen, Schüsse auf Schwarze Menschen: Betroffene berichten schon lange von rassistischen Erfahrungen mit der Polizei. Mittlerweile gibt es dazu repräsentative Forschung. Wir stellen sie in der neuen Podcastfolge vor. Mehr ...
Migration entlastet den Sozialstaat
Mehr Migration entlastet die öffentlichen Haushalte langfristig um rund 104 Milliarden Euro jährlich. Das ist das Ergebnis einer Expertise des "Wirtschaftsweisen" Prof. Martin Werding für den Mediendienst. Frühere Rechnungen waren zu einem gegenteiligen Ergebnis gekommen Mehr ...