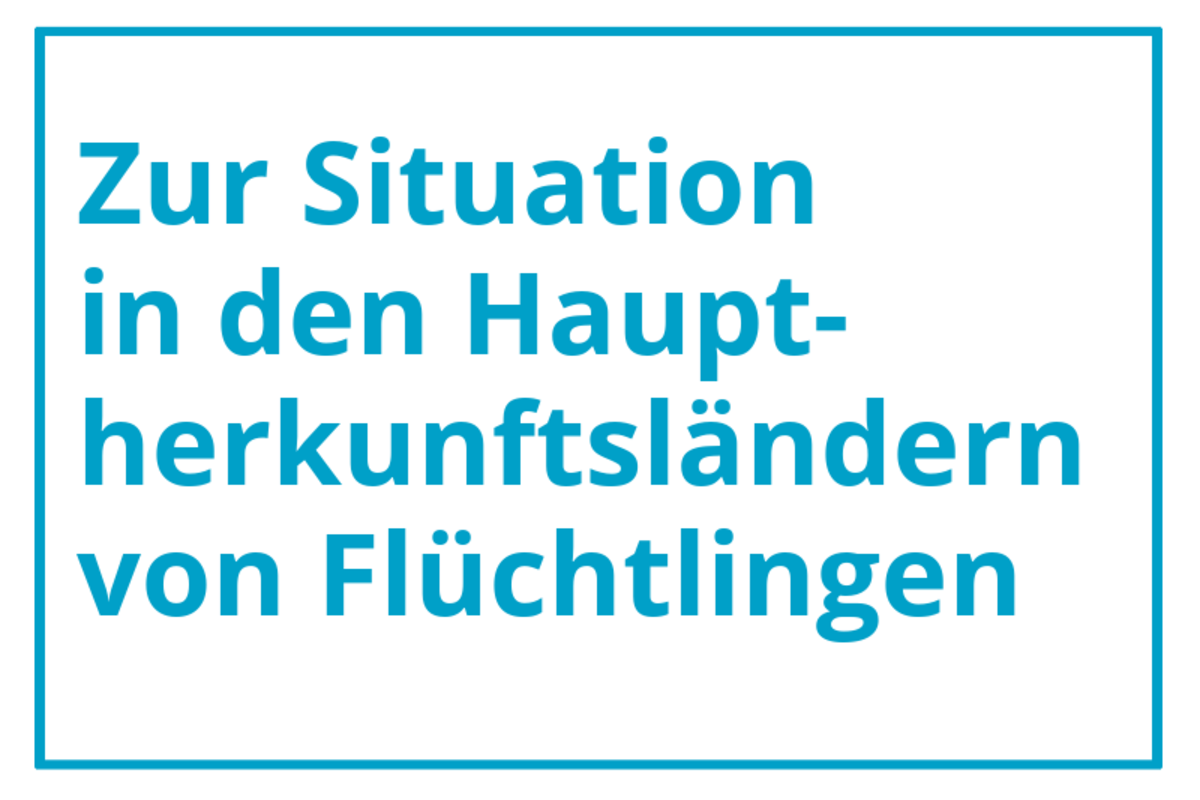Die "Bekämpfung von Fluchtursachen" ist kein neues Konzept. Erste Debatten hierzu gab es bereits nach dem Ersten Weltkrieg. In den letzten Jahren hat die Idee aber politisch an Bedeutung gewonnen. Im Zuge der "Flüchtlingskrise" hat die Bundesregierung umfangreiche Maßnahmenkataloge vorgelegt, um die "Ursachen des Migrationsdrucks deutlich zu reduzieren". Das spiegelt sich auch im Etat des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) wider: 2017 stehen dem BMZ acht Milliarden Euro zur Verfügung – so viel wie noch nie.
Im Fokus stehen dabei vor allem entwicklungspolitische Initiativen, die die wirtschaftliche Situation in den Herkunftsländern verbessern sollen: Armut reduzieren, Arbeitsplätze schaffen und Wirtschaftswachstum fördern. Dahinter steht die Annahme, dass bessere ökonomische Bedingungen Menschen davon abhalten können, ihre Heimat zu verlassen. Diese Vermutung scheint auf den ersten Blick logisch. Sie widerspricht jedoch den Erkenntnissen der Migrationsforschung.
Unzählige Studien zeigen, dass wirtschaftlicher Fortschritt Flucht nicht verhindern kann. Im Gegenteil tragen bessere ökonomische Bedingungen dazu bei, dass mehr Menschen in der Lage sind, ihre Heimat zu verlassen. Migration ist mit hohen Kosten verbunden. Menschen, die in Armut leben, können es sich in der Regel nicht leisten auszuwandern.
Eine europäische Entwicklungspolitik, die vornehmlich danach strebt, Menschen im globalen Süden zu immobilisieren, verliert ihre Glaubwürdigkeit, weil sie ausschließlich an den Interessen des globalen Nordens orientiert ist.
Wir müssen Gewalt als Ursache ernst nehmen
Gewalt forciert Migration. Millionen von Menschen haben weltweit ihre Heimat verlassen, weil Krieg herrscht, staatliche Strukturen zerfallen oder autoritäre politische Systeme Rechte und Lebensmöglichkeiten beschränken. Will Europa die Ursachen von Fluchtbewegungen angehen, muss es sich mit inner- und zwischenstaatlichen Konflikten auseinandersetzen, die in vielen Teilen der Welt Hintergrund von Gewalt sind.

Prof. Dr. JOCHEN OLTMER lehrt Neueste Geschichte an der Universität Osnabrück und ist dort seit 1997 Vorstandsmitglied des "Instituts für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien" (IMIS). Zuletzt erschien von ihm 2017 das Buch "Migration: Geschichte und Zukunft der Gegenwart".
Die aktuelle Lage in Kriegsgebieten wie Syrien oder dem Irak zeigt jedoch, wie schwierig das ist. Viele Krisen und Konflikte dauern zum Teil seit Jahren oder Jahrzehnten an. Eine globale Friedensordnung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Die Zahl der militärischen Konflikte hat sich in den vergangenen fünf Jahren erhöht, ebenso die Zahl der Opfer. Eine wirksame und zeitnahe "Bekämpfung" von staatlicher Gewalt im Kontext von Kriegen, Bürgerkriegen oder Maßnahmen autoritärer politischer Systeme als Fluchtursachen scheint daher im Moment kaum möglich zu sein. Es werden weiterhin viele Menschen ihre Heimat verlassen müssen.
Staaten müssen Geflüchtete besser schützen
Zu einem vermehrten Engagement für den Schutz von Geflüchteten gibt es folglich keine Alternative. Das Asylrecht hat nichts von seiner Bedeutung verloren. Aus guten Gründen haben 147 Staaten weltweit die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet und Regelungen entwickelt, um Menschen, die vor Gewalt ausweichen, zu schützen. Der Ausbau sogenannter Resettlement-Verfahren könnte einen Beitrag leisten, die Aufnahme von besonders schutzbedürftigen Menschen aus Kriegs- und Krisenregionen zu verbessern – denn kranke oder verletzte Personen, Kinder oder Ältere sind es, die am wenigsten in der Lage sind, durch Bewegungen über größere Distanzen oder Grenzen Schutz zu finden. Weltweit gibt es derzeit 80.000 solcher Resettlement-Plätze jährlich. Der tatsächliche Bedarf wird jedoch auf das Zehnfache geschätzt.
Zudem sollte das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) gestärkt werden. Um Hilfe leisten zu können, ist der UNHCR bislang hauptsächlich auf Spenden von Regierungen, zwischenstaatlichen Akteuren und Privatpersonen angewiesen. Die reguläre Finanzierung aus dem UN-Budget macht weniger als zwei Prozent aus. Mit einem eigenen Etat aber wäre der UNHCR in der Lage, Fluchtbewegungen frühzeitig zu erkennen und Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Humanitäre Katastrophen könnten so verhindert oder zumindest deutlich reduziert werden.
Sie sind Journalist*in und haben weitere Fragen oder suchen Fachleute zum Thema? Dann können Sie uns gern kontaktieren. Wir helfen schnell und unkompliziert. Unsere Texte und Grafiken können kostenfrei unter den Regeln der Creative Commons und unserer Namensnennung verwendet werden. Dies gilt nicht für Bilder und Fotos, die wir von Dritten erworben haben.