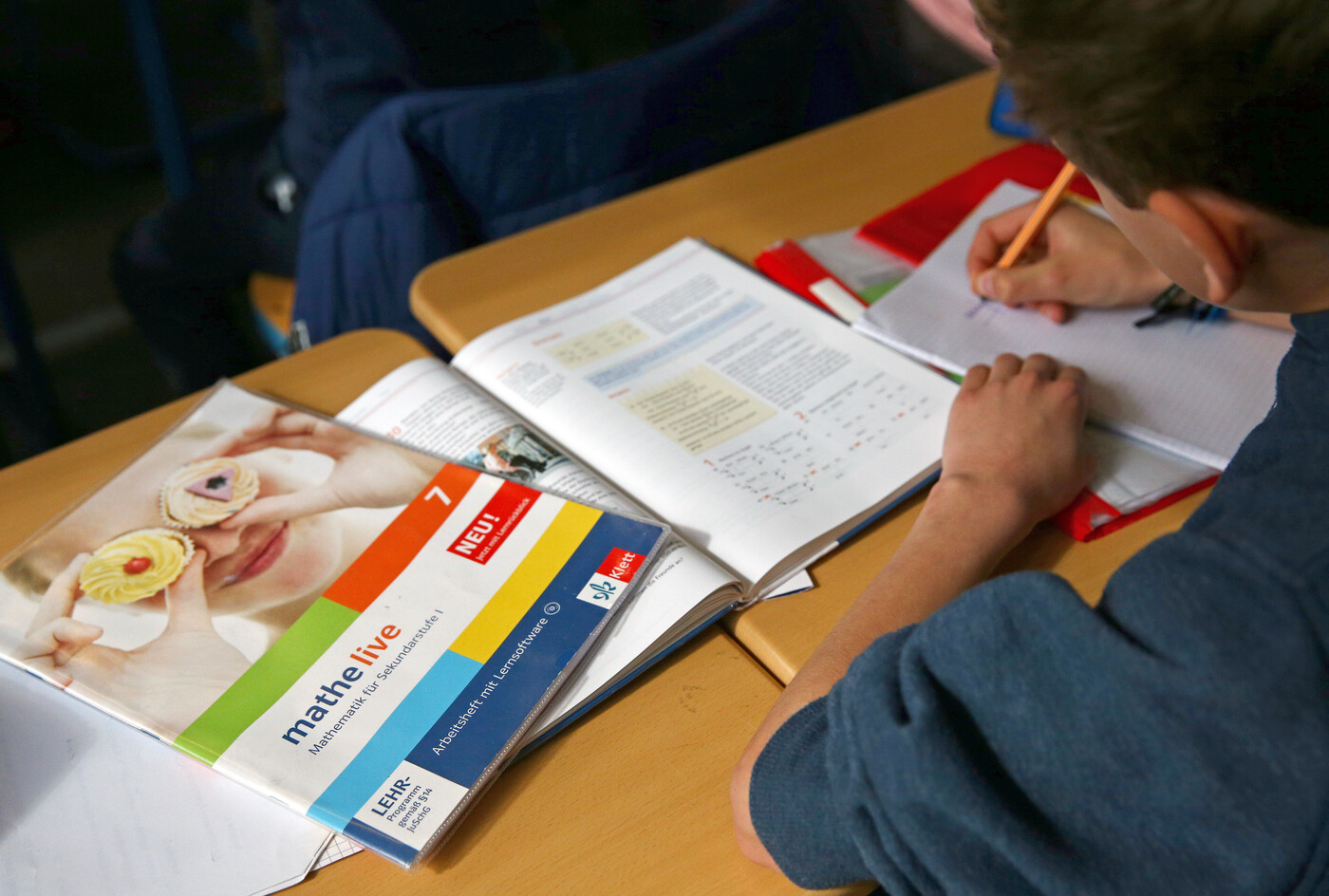MEDIENDIENST: Frau Onana, Sie vertreten die These, dass der Kolonialismus als Anti-Schwarzer Rassismus fortbesteht. Wie meinen Sie das?
Dr. Marie Biloa Onana: Die Denk- und Verhaltensweisen aus der Zeit des Kolonialismus wirken bis heute nach. Sie zeigen sich in rassistischer Diskriminierung Schwarzer Menschen: Ob in der Bildung, im Gesundheitssystem, auf dem Arbeits- oder Wohnungsmarkt - in der Weißen Mehrheitsgesellschaft gibt es immer noch die Erwartung, dass sich Schwarze Menschen unterordnen, genau wie zu Kolonialzeiten. Deshalb sprechen wir von Kontinuitäten.
Als Literaturwissenschaftlerin haben Sie sich damit auseinandergesetzt, welche Bilder von Schwarzen und Weißen Menschen die deutsche Literatur hervorgebracht hat. Welche sind das und was davon ist heute noch präsent?
Die deutsche Literatur von damals ist voll von kolonialen Fantasien über Schwarze und Weiße "Menschentypen" und deren angebliche kulturelle und intellektuelle Unterschiede. Und das schon, bevor das Deutsche Kaiserreich überhaupt eigene Kolonien hatte: Selbst progressive Denker wie Kant schlossen in Werken des 18. Jahrhunderts Schwarze Menschen von der Aufklärung aus, sprachen ihnen die Fähigkeit zu selbstbestimmtem Denken ab. Diese Klassiker sind immer noch präsent und prägen unser Denken.
Die Idee, dass Schwarze Menschen intellektuell unterlegen sind, kann man auch an der damaligen Literatur zur Haitianischen Revolution sehen: Der Begriff "Revolution" wird nicht verwendet, stattdessen ist von "Aufständen" die Rede. Dahinter steht die Annahme, Schwarze Menschen seien nicht zu reflektiertem, politischen Handeln fähig. Heute zeigt sich diese Denkweise beispielsweise daran, dass Schwarze Kinder in der Schule nachweislich von Lehrkräften diskriminiert werden, ihnen wird weniger zugetraut.
Welche weiteren Beispiele gibt es noch für koloniale Denkmuster?
Es gibt eine Reihe weiterer Eigenschaften, die Schwarzen Menschen damals zugeschrieben wurden und die sich bis heute halten. Wie das Stereotyp, sie seien sinnlicher und musikalischer, aber weniger vernunftgeleitet. Das kann sich zum Beispiel so äußern, dass ein*e Weiße*r regelmäßig auf Konzerte Schwarzer Künstler*innen geht – diese sozusagen in dem Kontext von Musik als kompetent wahrnimmt – aber Schwarze Menschen im Alltag ausgrenzt. Natürlich passiert das selten bewusst. Oft liegt das einfach an der Vorstellung, dass Schwarze und Weiße Menschen unterschiedliche Kompetenzen haben, die sich in unseren Köpfen verankert hat. Solche Denkmuster können aber mit verantwortlich dafür sein, dass Weiße Personen manchmal regelrecht überrascht sind, Schwarze Menschen in Fachberufen zu sehen, beispielsweise als Arzt oder Lehrer.
Gibt es Bereiche, in denen es Verbesserungen gibt?
Die stereotypen Rollenmuster halten sich im Großen und Ganzen leider hartnäckig. Aber nach jahrzehntelangem Aktivismus gegen Anti-Schwarzen Rassismus gibt es vereinzelt Fortschritte: Initiativen, die sich dafür einsetzen, nach Kolonialherren benannte Straßen und Plätze umzubenennen, haben in einigen Fällen ihre Ziele erreicht – beispielsweise ist das Afrikanische Viertel in Berlin-Wedding inzwischen zu einem Gedenkort geworden. Solche Symbole sind für den gesellschaftlichen Diskurs wichtig. Das haben wir uns hart erkämpft. Dabei ist aber wichtig festzuhalten: Rassismus ist ein strukturelles Problem in unserer Gesellschaft. Es fällt daher schwer, solche Mini-Erfolge wirklich zu feiern.
Was sollte aus Ihrer Sicht Priorität haben bei der Bekämpfung von Anti-Schwarzem Rassismus heute?
Nur durch Strukturen kann man einem strukturellen Problem begegnen. Beispielsweise brauchen wir Beratungsstellen an Schulen: Kinder, die im Schulalltag Rassismus erfahren, leiden oft still. Sie werden dadurch anfälliger für psychische Probleme. Anti-Schwarzer Rassismus sollte ein Bestandteil der Lehrer*innenausbildung werden, denn vielen fehlen sogar die Grundkenntnisse. Insgesamt liegt leider noch viel Arbeit vor uns.
Interview: Martha Otwinowski