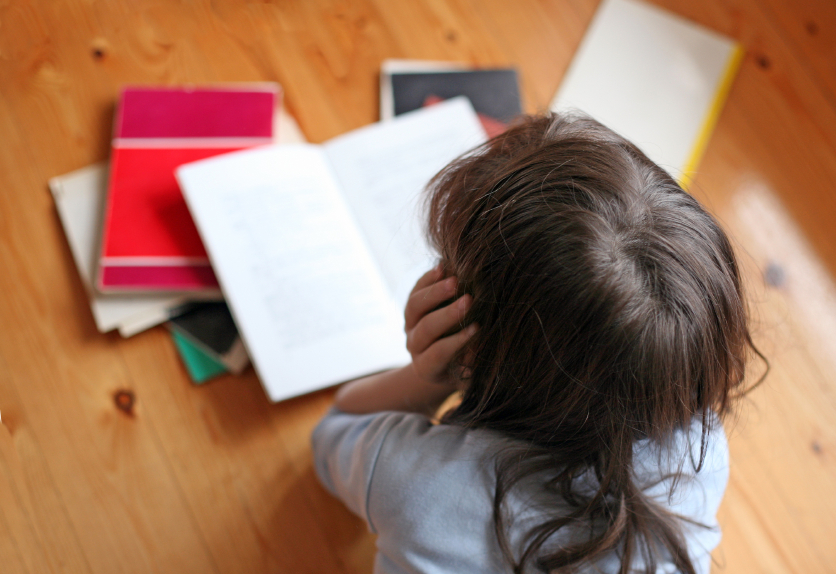Herr Fereidooni, Sie kritisieren "strukturelle" bzw. "institutionelle Diskriminierung" an Schulen. Was genau ist damit gemeint?
Bei institutioneller Diskriminierung geht es um Ungleichbehandlung, die bereits in den Strukturen, Abläufen oder im Unterricht stattfindet. Dazu zählt zum Beispiel, dass es hauptsächlich Englisch-, Französisch- und Spanisch-Leistungskurse gibt, aber keine Türkisch-, Arabisch- oder Russisch-LKs, obwohl ein erheblicher Anteil der Schüler in Deutschland diese Sprachen als Muttersprache spricht. Zu den strukturellen Problemen zählt aber auch die Selektion nach der vierten Klasse, an der sich die Lebenswege der Schülerinnen und Schüler teilen und die meiner Meinung nach zu früh geschieht. Das ist insbesondere für Kinder schädlich, deren Muttersprache nicht deutsch ist und die erst in der Grundschule anfangen, es zu lernen. Die Zeit, bis zur vierten Klasse ist dafür zu kurz.
Bedeutet dass, viele Schüler mit Migrationshintergrund landen auf Haupt- oder Förderschulen – unabhängig von ihren Schulnoten?
Nicht ganz. Es gibt Studien, die belegen, dass Grundschullehrkräfte vor allem auf zwei Faktoren achten, wenn sie Übergangsempfehlungen ausstellen: Erstens die Deutschnote. Da könnte man sagen, das ist ziemlich objektiv, weil es ja eine Ziffernnote ist. Es gibt allerdings zahlreiche Studien, die hinterfragen, wie verlässlich Schulnoten eigentlich sind. Auch Lehrer unterliegen Vorurteilen und Stereotypen. So hat Astrid Kaisereispielsweise belegt, dass Lehrerinnen und Lehrer ihre Schüler allein aufgrund ihrer Namen unterschiedlich einschätzen. Der zweite Aspekt ist die Erwartung an die Eltern, ihre Kinder auf der Weiterführenden Schule unterstützen zu können. Bei Eltern mit Migrationshintergrund gehen Lehrer häufig davon aus, dass sie das nicht leisten können.
Ist diese Einschätzung berechtigt?
Nein, diese Eltern werden oft unterschätzt. Viele Lehrer gehen davon aus, dass Bildung in Migrantenfamilien eine untergeordnete Rolle spielt. Das stimmt aber gar nicht. Mehrere Studienaben belegt, dass Kinder aus Migrantenfamilien ganz besonders vom sozialen Kapital ihrer Familien profitieren und dadurch einen Bildungsaufstieg erfahren können.
Was genau meinen Sie mit sozialem Kapital in Einwandererfamilien?
Damit ist die soziale und moralische Unterstützung der Familien gemeint. Wenn Eltern gegenüber ihren Kindern trotz knapper finanzieller Ressourcen und niedrigen Bildungsabschlüssen den Wert der Bildung immer wieder betonen. In meinem Sammelband „Das interkulturelle Lehrerzimmer“ beschreibt Ebru Tepecikeispielsweise eine Familie, die ihre Tochter gänzlich von der häuslichen Mitarbeit freigestellt hat, damit sie ihre ganze Zeit und Konzentration in die schulische Ausbildung investieren kann. Oft werden die Kinder auch von anderen Familienangehörigen, etwa von älteren Geschwistern, unterstützt.
Trotzdem: Die Frage, ob und wenn ja in welchem Maße es institutionelle Diskriminierung an Schulen gibt, wird doch innerhalb der Wissenschaft sehr unterschiedlich beantwortet.
Das sehe ich nicht so. Ich würde sagen, dass es mittlerweile einhellige Meinung ist, dass institutionelle Diskriminierung im deutschen Schulwesen besteht und insbesondere Kinder mit Migrationshintergrund davon betroffen sind.
Aber Cornelia Gresch schreibt 2012 beispielsweise, dass Kinder mit Migrationshintergrund am Ende der Grundschule nicht diskriminiert würden. Bei gleicher Leistung und sozialer Situation würden sie genau so häufig ans Gymnasium empfohlen.
Das muss kein Widerspruch sein. Kinder mit Migrationshintergrund sind überdurchschnittlich oft von Kinderarmut betroffen. Und deshalb haben sie auch schlechtere Karten. Cornelia Gresch , aber auch Jörg Rössel und Jörg Dollmannagen, dass im deutschen Schulwesen die soziale Herkunft und die Mechanismen der Schichtproduktion und -reproduktion ausschlaggebend sind und weniger der Migrationshintergrund. Kinder würden je nach sozialem Status entweder bevorzugt oder benachteiligt.
Und was sagen Sie dazu?
Diese Ursachenanalyse greift meiner Meinung nach zu kurz. Erstens bleiben dabei Forschungsergebnisse unberücksichtigt, wie etwa die von Rainer Geißler , die zeigen, dass Kinder mit Migrationshintergrund auch bei vergleichbarem sozialen Hintergrund seltener eine Gymnasialempfehlung erhalten, als herkunftsdeutsche Kinder. Zweitens hat die OECD, als sie die PISA-Studien veröffentlichte, die Unterschiede in der mathematischen Kompetenz zwischen Kindern aus herkunftsdeutschen und Zuwandererfamilien miteinander verglichen. Dabei kam heraus, dass die Ergebnisse zwar von der sozioökonomischen Herkunft beeinflusst werden, Unterschiede in den Ergebnissen aber auch unabhängig davon bestehen bleiben. Drittens hat Janina Söhnbenfalls am WZB ihre Dissertation vorgelegt und kam zu dem Schluss, dass der Aufenthaltsstatus von Migrantengruppen eine fundamentale Rolle für ihren Bildungserfolg spielt. Nicht zuletzt setzen Forscher wie Gresch etwas voraus, was es nicht gibt, nämlich eine vergleichbare Sozialschicht.
Welche Rolle spielen andere Formen der Diskriminierung?
Viele Schüler sind auch von direkter Diskriminierung betroffen. Zum Beispiel dann, wenn eine Lehrkraft sie persönlich beleidigt. Mark Terkessidis ist zum Beispiel in seiner Dissertation „Die Banalität des Rassismus“arauf eingegangen, indem er Schülerinnen und Schüler zu ihren Diskriminierungserfahrungen befragt hat. Ich denke aber, strukturelle Diskriminierung spielt eine tragende Rolle.
Sie haben in Ihrer Untersuchung ja auch über den Tellerrand geschaut. Ist das deutsche Schulsystem im Vergleich zu anderen besonders diskriminierend?
Es ist auf jeden Fall nicht sehr erfolgreich. Und man könnte von anderen OECD-Staaten wie Schweden, Kanada und Finnland lernen.
Was müsste getan werden, um die Lernchancen aller zu verbessern?
Erstens müsste Deutschland die Investitionen im Bildungsbereich steigern oder zumindest umverteilen und mehr Geld in Kindergärten und Grundschulen investieren, um mehr besser ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher anzustellen.
Zweitens muss die frühzeitige Selektion nach der vierten Klasse zugunsten längerer gemeinsamer Beschulungszeiten beseitigt werden. Die TIES-Studie hat den Bildungserfolg der Nachkommen so genannter Arbeitsmigranten aus der Türkei, Marokko und dem ehemaligen Jugoslawien in acht europäischen Staaten untersucht. Sie kam zu dem Ergebnis dass je länger Kinder mit und ohne Migrationshintergrund gemeinsam zur Schule gehen, desto wahrscheinlicher erlangen die Kinder aus Einwandererfamilien das Abitur und einen Hochschulabschluss.
Als dritte Reformmaßnahme brauchen wir nicht mehr, sondern weniger Schulformen, also die Gesamtschule wie in anderen Staaten auch. Hier werden die so genannten leistungsstarken und leistungsschwachen Kinder gemeinsam beschult. So können beide voneinander lernen. Es gibt nämlich keine bessere Methode zum lernen, als den Stoff selbst anderen zu vermitteln.
Viertens müsste Interkulturelle Pädagogik in der Lehreraus- und Fortbildung nicht Wahl- sondern Pflichtfach sein.
Und fünftens sollte der Bildungswert der Muttersprachen in der Schule ernster genommen werden.
 Karim Fereidooni, Jahrgang 1983, ist Autor von „Schule – Migration – Diskriminierung“ und Herausgeber des Sammelbandes „Das Interkulturelle Lehrerzimmer“. Er arbeitet als Lehrer für die Fächer Deutsch und Sozialwissenschaften an einem Gymnasium in Nordrhein-Westfalen. Der Stipendiat der Stiftung der Deutschen Wirtschaft promoviert über „Diskriminierungserfahrungen von Lehrkräften mit Migrationshintergrund im deutschen Schulwesen“. Darüber hinaus ist er Mitglied im Netzwerk „Lehrer mit Zuwanderungsgeschichte NRW“. Weitere Informationen finden Sie in seinem Aufsatz zur Benachteiligung von Schülern mit Migrationshintergrund.
Karim Fereidooni, Jahrgang 1983, ist Autor von „Schule – Migration – Diskriminierung“ und Herausgeber des Sammelbandes „Das Interkulturelle Lehrerzimmer“. Er arbeitet als Lehrer für die Fächer Deutsch und Sozialwissenschaften an einem Gymnasium in Nordrhein-Westfalen. Der Stipendiat der Stiftung der Deutschen Wirtschaft promoviert über „Diskriminierungserfahrungen von Lehrkräften mit Migrationshintergrund im deutschen Schulwesen“. Darüber hinaus ist er Mitglied im Netzwerk „Lehrer mit Zuwanderungsgeschichte NRW“. Weitere Informationen finden Sie in seinem Aufsatz zur Benachteiligung von Schülern mit Migrationshintergrund.
Interview: Rana Göroglu