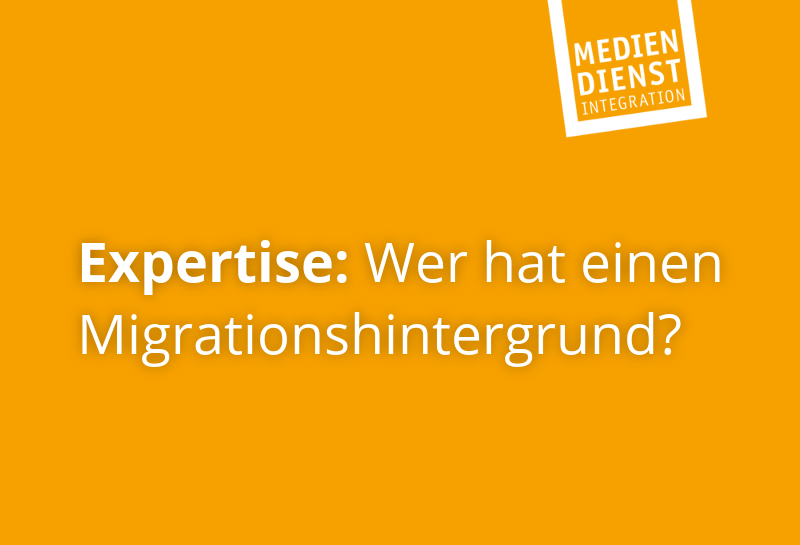MEDIENDIENST: Sie fordern, dass in Deutschland mehr Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten erhoben werden. Warum sind solche Daten wichtig?
Daniel Gyamerah : Weil sie zeigen können, wo es Ungleichbehandlung gibt. Für bestimmte Gruppen fehlen diese Daten bisher. Wir wissen zum Beispiel nicht, wie viele Menschen von rassistischer Diskriminierung betroffen sind. Das liegt daran, dass Statistiken lediglich den "Migrationshintergrund" erheben. Der erfasst aber nicht alle Menschen, die rassistisch diskriminiert werden.
Warum nicht?
Ein Beispiel: Jemand mit einem weißen deutschen Vater und einer weißen schwedischen Mutter wird vermutlich keine rassistische Diskriminierung erleben, weil er keinen erkennbaren Migrationshintergrund hat. Eine Frau of Color hingegen – ob mit oder ohne Migrationshintergrund – erlebt vermutlich jeden Tag, dass sie anders behandelt wird. Wir brauchen mehr Daten, um so etwas sichtbar zu machen und betroffene Gruppen zu stärken.
Um welche Daten geht es genau?
Wir brauchen Daten zu allen Diskriminierungs-Merkmalen, die im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz stehen: also Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter und sexuelle Identität. Darüber hinaus wären Daten hilfreich, die etwas über die soziale Herkunft aussagen – und darüber, ob jemand als ostdeutsch gesehen wird. Aufgrund welcher Zuschreibungen erlebt man Diskriminierung? Diese Perspektive soll rein in die Statistiken.
Das sind sehr persönliche Daten. Ist es nicht problematisch, so etwas zu erfassen?
Uns ist natürlich bewusst, dass das ein heikler Bereich ist. Aber wir denken, dass sich öffentliche Institutionen für diese Art von Erhebung interessieren sollten, denn nur so können sie effektiv etwas gegen Diskriminierung und für Gleichstellung tun. Unser Forschungsteam hat in Berlin eine Pilotuntersuchung durchgeführt und Führungskräfte in der Verwaltung befragt. Da sind sehr spannende Ergebnisse rausgekommen: Knapp elf Prozent der Befragten gaben an, einen "Migrationshintergrund" zu haben. Nur drei Prozent sehen sich als People of Color. Von ihnen sagten alle, dass sie schon mal rassistische Diskriminierung erlebt haben.
Eine weitere Untersuchung ist in Thüringen geplant. Ihr Forschungsinstitut will 20.000 Beschäftigte in der Verwaltung befragen, wie sie Vielfalt und Diskriminierung am Arbeitsplatz erleben. Einige Medien haben kritisiert, dass damit hochsensible Daten gesammelt würden. Wie stehen Sie zu der Kritik?
In den Medienberichten wurden einige Zusammenhänge falsch dargestellt. Zum Beispiel hieß es, die Landesregierung wolle hochsensible und intime Details ihrer Angestellten abfragen – das würden wir auch kritisch sehen. Richtig ist: Wir als Forschungsinstitut erheben Daten zu Diskriminierungserfahrungen. Niemand muss an der Befragung teilnehmen, jede Antwort ist freiwillig. Wer teilnimmt, kann sicher sein, dass die Verwaltung als Arbeitgeberin nichts von den Antworten erfährt. Sie hat keinen Zugriff auf den Datensatz oder unsere Server, sondern erhält später nur eine Auswertung, die aggregiert und anonymisiert ist und keine Rückschlüsse auf einzelne Personen erlaubt.
Der Antirassismus-Ausschuss der Vereinten Nationen forderte 2015 von der Bundesregierung, mehr Daten zu rassistischer Diskriminierung zu erheben. Die lehnt das bis heute ab mit der Begründung, Deutschland könne wegen seiner historischen Erfahrung mit der Nazizeit keine Daten "auf ethnischer Basis" erfassen. Was sagen Sie dazu?
Hier duckt sich die Bundesregierung vor einem schwierigen Thema weg. Natürlich darf es keine rassistische Forschung geben. Aber Forschung zu Diskriminierung sehr wohl und die braucht verlässliche Daten. Fast alle regelmäßigen Bevölkerungsumfragen fallen beim Thema rassistische Diskriminierung durch – das zeigt eine Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Rassistische Diskriminierung wird in keiner der großen Bevölkerungsbefragungen wie zum Beispiel dem Mikrozensus erhoben.
Auch bestimmte Gruppen, zum Beispiel Sinti und Roma, sehen das Risiko, dass solche Daten missbraucht werden könnten, und verweisen auf die systematischen Verfolgungen während des Nationalsozialismus. Können Sie diese Sorgen verstehen?
Diese Sorgen sind absolut berechtigt. Allerdings betonen viele Roma und Sinti auch, wie wichtig wirkliche Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten wären. Wir haben deshalb unterschiedliche Communities in die Erarbeitung unseres Fragebogens mit einbezogen. Ein Arbeitskreis von Roma und Sinti hat 2016 gefordert, darauf zu achten, dass Befragte durch die Teilnahme an einer Befragung keinen Schaden erleiden. Das haben wir berücksichtigt. Zudem achten wir auf sechs weitere Kernprinzipien , die im europäischen Kontext für solche Befragungen erarbeitet wurden.
In welchen Ländern werden Gleichstellungsdaten schon erfasst? Was hat sich dort geändert?
In Großbritannien werden seit Jahren systematisch Daten zu Gleichstellung und rassistischer Diskriminierung erhoben und ausgewertet – zum Beispiel im "Race Disparity Audit". Dadurch ist Vielfalt vom abstrakten Ziel zur konkret messbaren Größe geworden. Auch in Deutschland gibt es schon ein gutes Beispiel: die Debatte um geschlechtergerechte Bezahlung und die Repräsentation von Frauen. Dazu werden die Daten schon lange statistisch ausgewertet. Inzwischen gibt es detaillierte Berechnungen, wie hoch der Lohnunterschied in verschiedenen Bereichen ist. Das zeigt, wie groß die Ungleichbehandlungen sind – und hat dazu beigetragen, dass es erste Verbesserungen gibt.
Interview: Carsten Janke
Wichtige Quellen:
Citizens For Europe : Einführung zu Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten / pdfNeue Deutsche Organisationen : Dossier mit Fakten, Statements und Videos zu Gleichstellungsdaten / LinkVielfalt entscheidet : Übersicht bisheriger Erhebungen zu Gleichstellungsdaten in Deutschland / Link