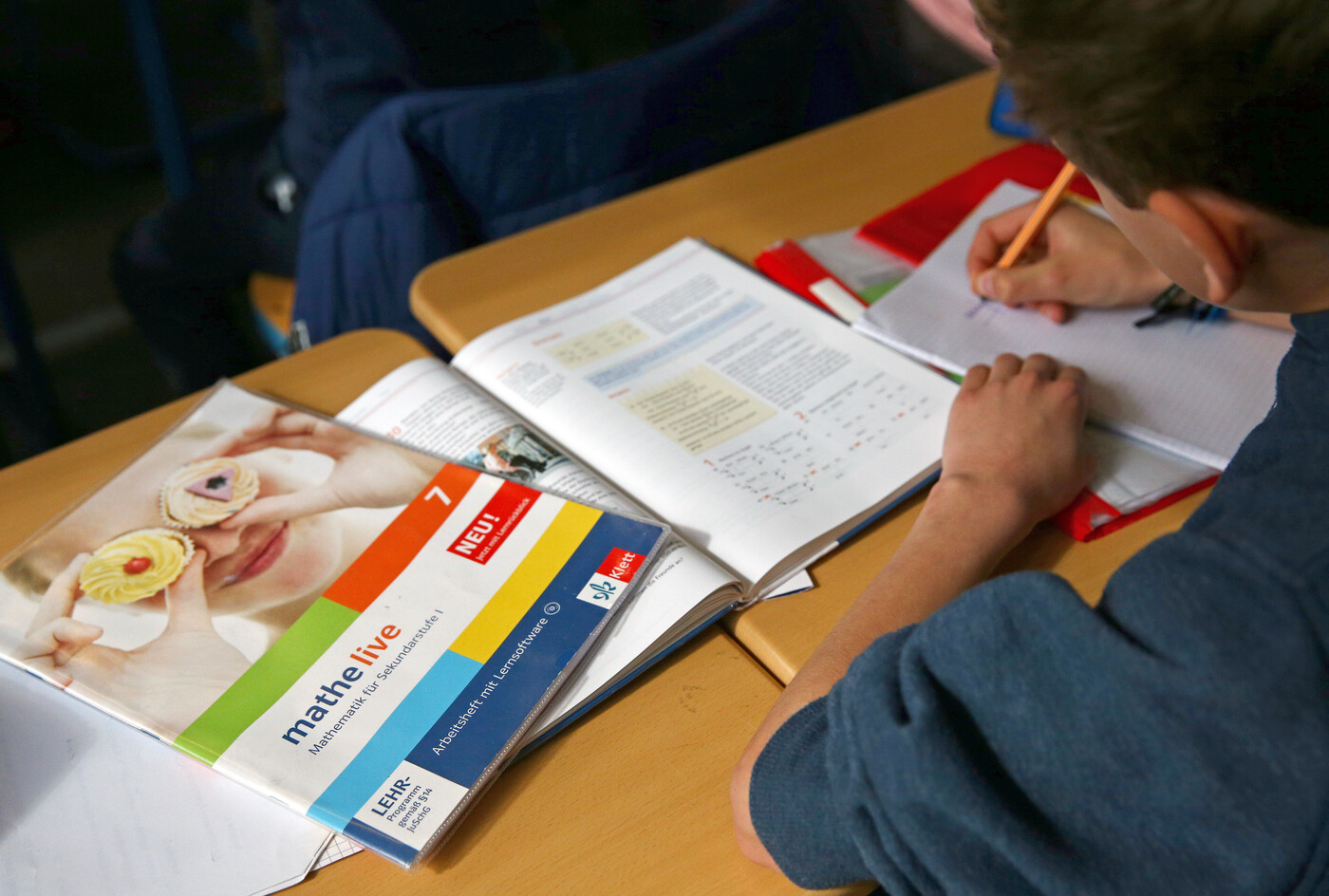MEDIENDIENST Integration: Frau Karakayali, wie reagieren Schulen auf Beschwerden über Rassismus?
Prof. Dr. Juliane Karakayali: Schulen haben einen großen Spielraum, nicht auf Beschwerden einzugehen - das ist ein großes Problem. Schulleitungen und Lehrkräfte haben verschiedene Abwehrstrategien entwickelt, mit denen sie auf Beschwerden über Rassismus und Antisemitismus reagieren. Dazu gehört, dass Schüler*innen und Erziehungsberechtigte keine Besprechungstermine angeboten bekommen. Oder aber, dass eine Lehrkraft sich im Kolleg*innenkreis eine Bestätigung darüber einholt, dass der Umgang mit einer Situation in Ordnung war, obwohl dies nicht der Fall war.
Das heißt, ein Teil der betroffenen Schüler*innen dringen gar nicht mit ihren Beschwerden durch?
Genau. Oder sie erleben, dass es zu einer Umkehr von Opfer und Täter*in kommt, indem auf früheres "problematisches" Verhalten der Schüler*innen verwiesen wird. Wir haben in unseren Befragungen außerdem gehört, dass Schulen Vorfälle delegitimieren, indem sie der betroffenen Person eine Übersensibilität zuschreiben oder sie als querulantische Person abstempeln. Eine weitere sehr problematische Strategie im Umgang mit Beschwerden ist, eine Bestrafung zu verhängen. Oftmals werden Beschwerden auch so lange verschleppt, dass zum Schluss nicht mehr auf sie eingegangen wird.
Was macht so etwas mit den Betroffenen?
Problematisch ist, dass den Betroffenen ihre Erfahrungen abgesprochen werden. Schüler*innen und ihre Eltern haben dann nicht das Gefühl, dass es sinnvoll ist, ihre Beschwerden weiterzuverfolgen. Mitarbeiter*innen aus den Beratungsstellen haben uns berichtet, dass sich rassistisches Mobbing nach einer Beschwerde verschärfen kann. Viele Schüler*innen sind deshalb schnell eingeschüchtert und auch bei den Erziehungsberechtigten zeigt sich eine hohe Frustration. Schließlich müssen Schüler*innen täglich in die Schule gehen und von ihren Noten hängen ihre weiteren Chancen im Leben ab.
In derStudiewurden Interviews mit Personen von externen Beratungs- und Beschwerdestellen für (institutionellen) Rassismus geführt. Das Ziel war es, einen Überblick darüber zu bekommen, wie an Schulen mit Beschwerden über Rassismus umgegangen wird.
An wen können sich Schüler*innen und Eltern überhaupt bei Beschwerden wenden?
Mit unserer Studie haben wir versucht, genau das herauszufinden. Die Frage ist nicht so leicht zu beantworten, da es kein einheitliches Vorgehen gibt. Meist werden die Vorfälle Lehrkräften oder Vertrauenslehrer*innen gemeldet, die diese dann an die Schulleitung weiterleiten. Sollte der Vorfall hier nicht geklärt werden, wird der Fall an die Schulaufsicht übergeben. Ein Problem ist, dass weder Schulleitungen noch die Schulaufsicht regelhaft geschult werden in Fragen von Diskriminierung. Deshalb werden Beschwerden, wenn auf sie eingegangen wird, wie ein Konflikt behandelt. Diese Art von Umgang wird dem eigentlichen Problem jedoch nicht gerecht. Viele Betroffene wenden sich deshalb an externe Beratungs- und Beschwerdestellen. Die sind der Schule gegenüber aber nicht weisungsbefugt. Immerhin hat sich die Anzahl dieser Anlaufstellen in den letzten Jahren in positiver Weise erhöht.
Handelt es sich bei dem Umgang mit Beschwerden um Einzelfälle?
Nein, das sind keine Einzelfälle. Der Umgang spiegelt eine generelle Haltung der Gesellschaft sowie der Politik wider. Natürlich gibt es Schulen, Lehrkräfte und Schulleitungen, die aktiv mit Beratungs- und Beschwerdestellen zusammenarbeiten oder die Lehrkräfte fortbilden. Das Problem liegt in der mangelnden Unterstützung durch Politik oder Verwaltung. In Deutschland gibt es keinen spezifischen Diskriminierungsschutz an Schulen. Menschen- und Kinderrechte sowie ein allgemeines Antidiskriminierungsrecht existieren, aber keine direkten Vorgaben, die die Situation und den Umgang an der Schule verbessern würden.
Welche Maßnahmen können zu einer Verbesserung der Situation beitragen?
Auch wenn einige Schulen sich auf den Weg machen, neue Verfahren im Umgang mit Rassismus und Beschwerden darüber zu etablieren, hängt das doch immer vom Engagement Einzelner ab. In vielen Schulen ist nicht unbedingt Wissen über Rassismus vorhanden oder es ist sehr ungleich verteilt. Deshalb fehlt es Lehrkräften oft an Sensibilität gegenüber rassistischen Äußerungen und rassistischen Inhalten in Schulbüchern. Es wäre deshalb wichtig, schon im Studium gegen das Wissensdefizit vorzugehen. Viele Schulen haben außerdem zu wenig Ressourcen, im Schulalltag Fortbildungen zu ermöglichen, auch daran müsste sich etwas ändern. Die Politik ist in der Verantwortung, da einen Rahmen vorzugeben. Wichtig wären auch gesetzliche Vorgaben zu direkten Anlaufstellen an Schulen, wie Rassismus-Beauftragten oder Beschwerdestellen.
Interview: Lina Steiner