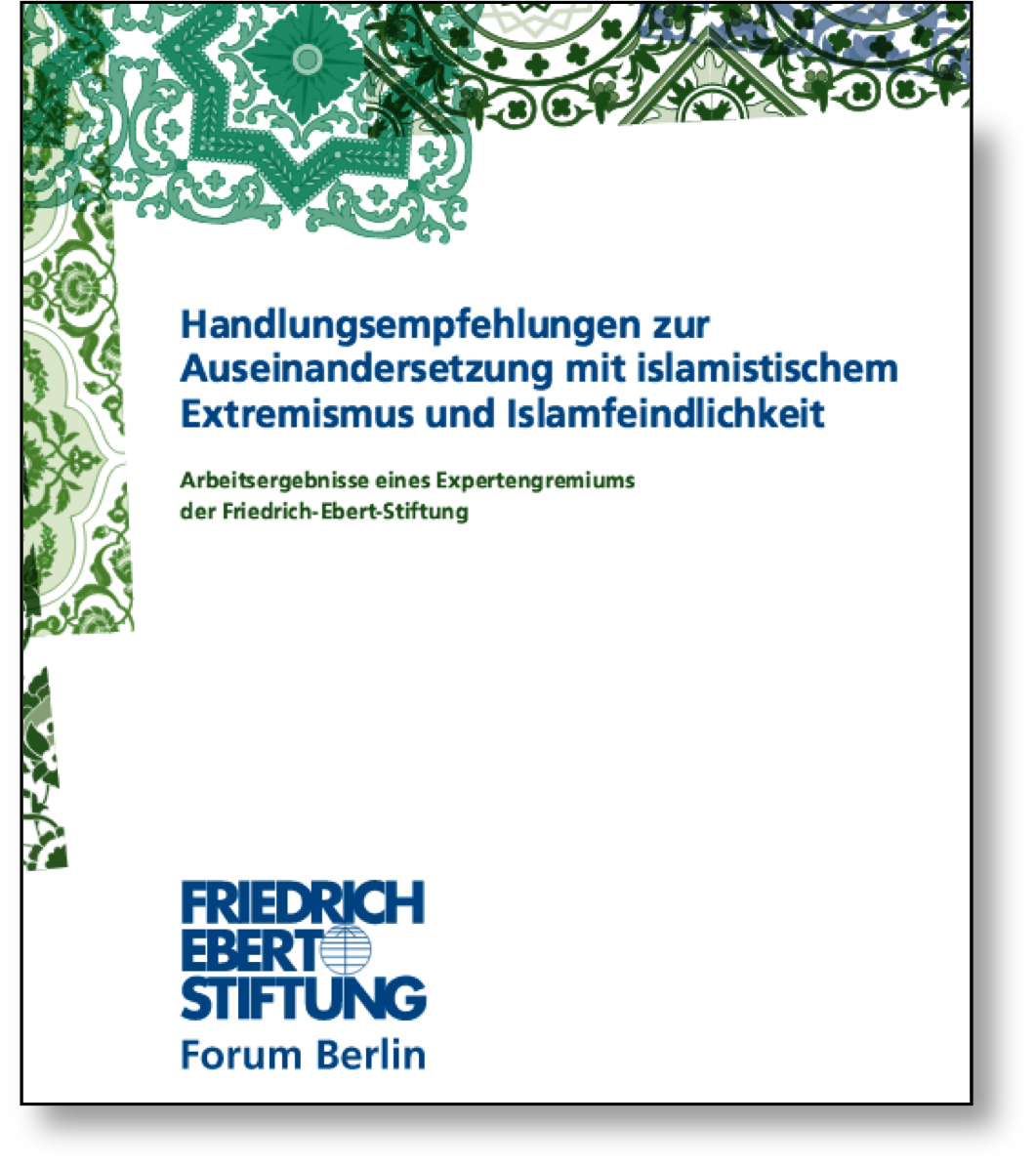In den Tagen nach den Terroranschlägen von Paris ist es in Großbritannien zu deutlich mehr muslimfeindlichen Übergriffen gekommen, wie Medien berichteten. Journalisten führten das unter anderem auf die intensive und teilweise polarisierende Berichterstattung zurück, die nach den Anschlägen in britischen Medien stattgefunden hat. In Deutschland ist die Ausgangssituation eine andere: Hier lobte der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) die besonnene Reaktion der Medien. Journalisten hätten es trotz hohen Zeitdrucks geschafft, sauber zu recherchieren und sich nicht "vor den Karren perfider Stimmungsmache spannen zu lassen", sagte der DJV-Vorsitzende Frank Überall.Journalisten scheinen sich besonders zu bemühen, im Fall von islamistisch begründeten Terroranschlägen distanziert und sorgfältig zu berichten. Angesichts der Art und Weise, wie die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) ihre Attentate verübt, stehen sie allerdings vor neuen Herausforderungen, und diese werden in den Medien breit diskutiert. Der MEDIENDIENST fasst die Argumente aus verschiedenen Beiträgen zusammen, aus denen sich Tipps für die Berichterstattung über den sogenannten "IS" ableiten lassen.
Was sollte man bei der Recherche beachten?
Verlässliche Quellezu finden, ist bei diesem Thema besonders schwierig, wie der Journalist und Terrorismus-Experte Yassin Musharbash in einem Artikel für die ZEIT schreibt. Journalisten seien oft auf dubiose Quelleaus dem Umfeld des "IS" angewiesen. Auf der anderen Seite hielten Sicherheitsbehörden Informationen aus taktischen Gründen zurück. Medienschaffende sollten deshalb keinen Artikel veröffentlichen, der "ausschließlich auf Informationen der einen oder der anderen oder einer dritten Seite beruht". Sollten am Ende einer Recherche nicht alle Fragen beantwortet sein, so ist besonders bei diesem Thema Transparenz wichtig, so Musharbash: "Das Einräumen von Zweifeln, blinden Flecken und Restriktionen erhöht unsere Unabhängigkeit."Welche Formulierungen sind angemessen?
Ein Attentat sollte nicht zu früh als "islamistisch" bezeichnet werden. Das lässt sich aus Empfehlungen ableiten, die der Forschungsbereich des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) in einer Studieegeben hat. Es sollte auf ein "vorschnelles Framing von Ereignissen im Kontext des Islam oder der Muslime" verzichtet werden. Wie wichtig das in Bezug auf Terroranschläge ist, zeigte das Beispiel des norwegischen Attentäters Anders Breivik im Jahr 2011. Einige Medien hatten kurz nach den Anschlägen über einen islamistischen Hintergrund spekuliert und wurden dafür später scharf kritisiert.Bei der Wortwahl sollte wertfrei, korrekt und präzise formuliert werden, betont die Initiative "Neue Deutsche Medienmacher". Sie hat das Glossar "Formulierungshilfen für die Berichterstattung im Einwanderungsland" herausgegeben. Mehrere Begriffe sollten mit Vorsicht verwendet werden, die häufig im Kontext von Berichten über den "IS" auftauchen, so zum Beispiel Dschihadist, islamistischer Terrorist oder radikale Muslime.Ausführlich wird darüber diskutiert, welche Bezeichnung für die Terrororganisation "Islamischer Staat" selbst zutreffend ist. Der "IS" hat bereits mehrfach seinen Namen geändert und für Journalisten kann es schwierig sein, die Übersicht zu behalten. Zwar stammt die Bezeichnung "Islamischer Staat" aus der Propagandasprache des "IS" und ist deshalb problematisch. Der Terrorismus-Experte Peter Neumann betont allerdings, dass die Verwendung möglich sei, da die meisten Nutzer sich des Propaganda-Gehalts bewusst seien. Um diesen hervorzuheben, greifen einige Journalisten auf den Zusatz "sogenannter" zurück oder sie setzen IS in Anführungszeichen. In Frankreich wird offiziell der Name "Daesh" gebraucht. Er leitet sich von der Abkürzung des arabischen Namens der Terrororganisation ab und wird von den Terroristen selbst abgelehnt, da er ähnlich klingt wie das arabische Wort für "niedertreten".Manche Kritiker sehen Risiken in der Personalisierung von Attentätern . Die Beschreibung biografischer Details könne dazu führen, dass diese dadurch erst zu wichtigen Akteuren “hochgeschrieben” werden. Es entstehe das Risiko, dass Sympathisanten sich mit den Dargestellten identifizieren. Die Journalistin Ruth Schneeberger wirft deshalb in der SZ die Frage auf, “ob jeder Attentäter mit Namen genannt und mit Foto gezeigt werden muss.”Bei allen Berichten über den "IS" empfiehlt der Journalist Yassin Musharbash in einem Interview, sich vor der Veröffentlichung die Frage zu stellen: “Komme ich mit der Darstellung den Terroristen zu weit entgegen?”
Welche Bilder sollten ausgewählt werden?
Die Bildauswahl sollte bei diesem Thema besonders sorgfältig geschehen, denn der "IS" versucht die Bilder nach Anschlägen gezielt "auszuschlachten", betont Musharbash. Dies geschehe vor allem über die sozialen Netzwerke und mit dem Ziel, neue Mitglieder anzusprechen. Der "IS" stelle seine Kämpfer gern als "moderne Che Guevaras" dar, analysiert der kanadische Menschenrechtler Kyle Matthews in einem Online-Artikel bei der Deutschen Welle.Mit den Gewalt-Videos des "IS" verbreite er außerdem "erfolgreich Angst und Schrecken" bei seinen Gegnern, schreibt die Korrespondentin Andrea Böhm in der ZEIT. Die Aufnahmen können durch ihre bewusste Inszenierung von brutaler Gewalt eine geradezu hypnotische Wirkung entfalten. Durch die Berichterstattung über diese Videos schaffe es die Terrororganisation, von ihren eigentlichen Misserfolgen abzulenken und die Debatte zu bestimmen.Der Journalist Stefan Winterbauer weist in einem Beitrag darauf hin, dass gegenwärtig viel Bildmaterial verwendet wird, das nicht wie bisher von Zeugen oder Journalisten stamme, sondern von den Terroristen selbst. Journalisten sollten deshalb intensiv prüfen, ob eine Veröffentlichung tatsächlich hilfreich für ein besseres Verständnis ist.Ausblick
Die Berichterstattung über Islam und Muslime ist in Deutschland stark von negativen Themen geprägt, besonders vom islamistisch motivierten Terrorismus, wie mehrere Studien belegen. Es sollte weiterhin sachlich und angemessen berichtet werden, um bestehende Vorurteile gegen Muslime in Deutschland nicht zu schüren. Andernfalls tue sich "für beide Seiten der Einwanderungsgesellschaft eine Kluft" auf, warnen Experten des SVR-Forschungsbereichs in der Studieum Thema. Medienbilder würden immer stärker von den persönlichen Erfahrungen des funktionierenden Zusammenlebens abweichen. Die Experten schließen mit einem versöhnlichen Ausblick: "Das soziale Miteinander funktioniert alles in allem gut."Von Carsten Janke