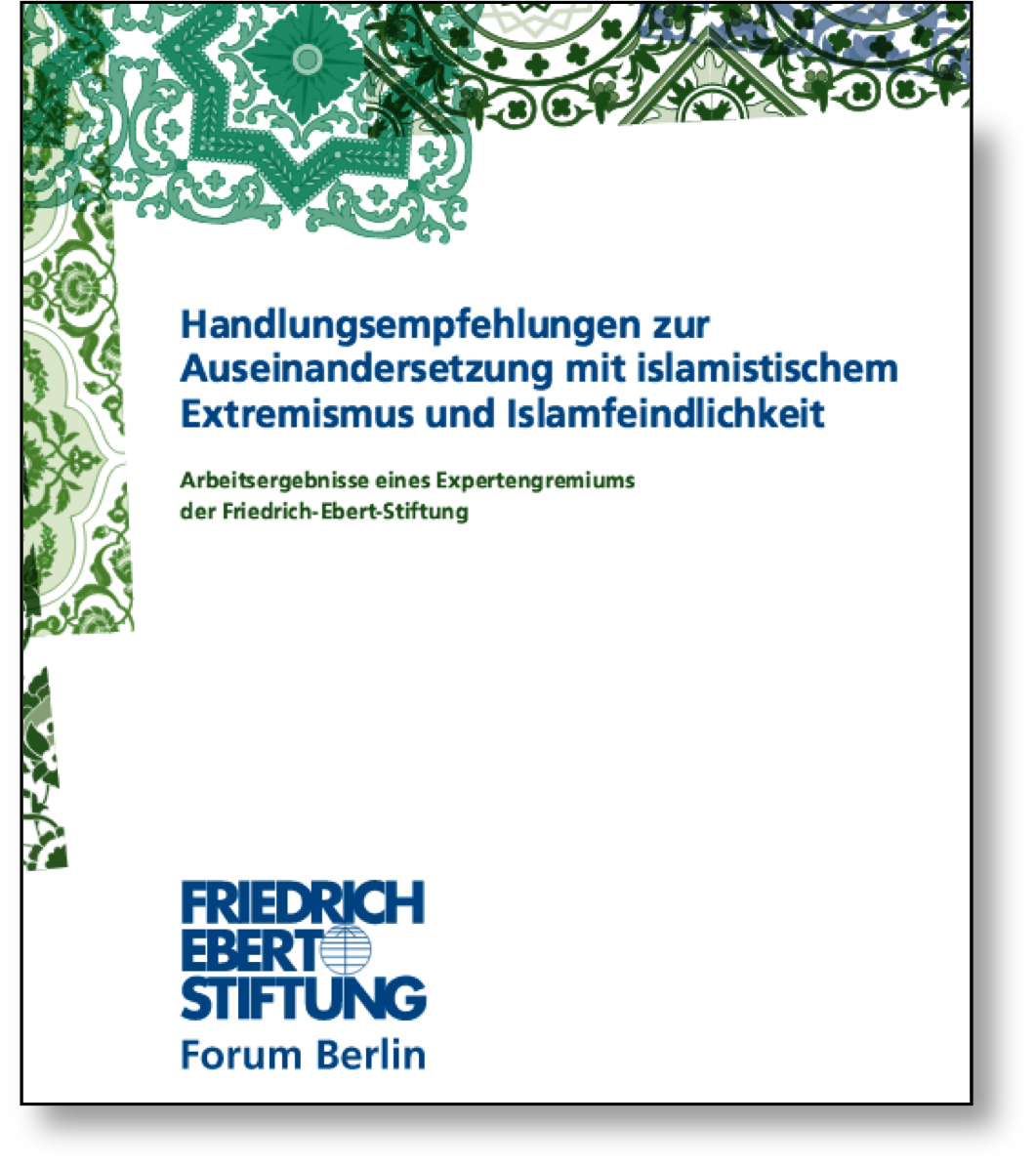Im November 2015 sprach der Präsident des Bundeskriminalamts, Holger Münch, in einem Interview mit der Tageszeitung "Die Welt" von einer ernst zu nehmenden Bedrohungslage durch islamistischen Extremismus in Deutschland. Auch eine kurz zuvor veröffentlichte Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) weist darauf hin, dass islamistischer Extremismusine reale Gefahr für Deutschland darstellt.Zu Recht: Seit dem Jahr 2000 wurden hierzulande neun islamistische Anschlagsversuche durch Sicherheitsbehörden vereitelt. Zwei weitere Anschläge scheiterten aufgrund von technischen Fehlern. Beim bislang einzigen islamistisch motivierten Anschlag mit Todesopfern verloren zwei US-amerikanische Soldatenhr Leben am Frankfurter Flughafen. Der Täter, ein 21 Jahre alter Kosovo-Albaner, lebte seit seinem elften Lebensjahr in Deutschland, wo er zwischenzeitlich ein Gymnasium besuchte. Laut Medienberichten hatte er sich im Internet radikalisiert.
Islamistischer Extremismus – auch ein deutsches Problem
Anschläge wie der vom Frankfurter Flughafen verdeutlichen, dass islamistischer Terrorismus kein rein von außen an Deutschland herangetragenes Problem ist – einige aktive Extremisten sind gebürtige Deutsche oder leben seit Langem in der Bundesrepublik. Das Erstarken des sogenannten Islamischen Staats (IS) treibt diesen Trend weiter voran: Laut der FES-Studie sind rund 700 Menschen seit 2012 aus Deutschland in IS-Herrschaftsgebiete ausgereist – möglicherweise, um sich dort in Trainingscamps ausbilden zu lassen. Zwar ist hierzulande bislang keiner der rund 200 "Rückkehrer" terroristisch aktiv geworden. Aber die von Rückkehrern verübten Anschläge auf das Jüdische Museum Brüssel und die französische Satire-Zeitschrift Charlie Hebdo zeigen, weshalb sie von deutschen Sicherheitsbehörden als gefährlich eingestuft und überwacht werden. Was aber wissen wir über die Beweggründe von Rückkehrern? Sind bestimmte Bevölkerungsgruppen besonders anfällig für die Propaganda extremistischer Organisationen?Wie werden Menschen zu Extremisten?
In der FES-Studie wird mehrfach darauf hingewiesen, dass es deneinen Auslöser für Radikalisierung nicht gibt. Als erforscht gilt jedoch eine Reihe von Umständen, die ein Abdriften ins islamistische oder auch rechtsextremistische Spektrum begünstigen. Dazu zählen unter anderem:-
eine autoritäre Erziehung mit innerfamiliären Gewalterfahrungen,
-
konfliktgeladene Familienverhältnisse (oft in Verbindung mit einer Trennung der Eltern),
-
eine geringe psychische Stabilität bei Jugendlichen,
-
eigene Diskriminierungserfahrungen
-
und das Bestehen von Kontakten zu Anhängern der jeweiligen extremistischen Szene.
Diese Umstände führen jedoch nicht zwangsläufig zu einer Radikalisierung. Im Gegenteil: Die Mehrheit aller Jugendlichen, die den obenstehenden Einflüssen ausgesetzt sind, bleibt extremistischen Bewegungen fern.Quelle So betonen die Wissenschaftler Andreas Zick und Nils Böckler in der FES-Studie, dass sich ein Prototyp eines in Deutschland aktiven Dschihadisten nur schwer skizzieren lässt. Würde man es trotzdem versuchen, wäre diese Person laut den Forschern männlich, im Durchschnitt 24 Jahre alt und mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein deutscher Staatsbürger. Sie wäre in der Regel gut ausgebildet, befände sich aber in einem schlechten Arbeitsverhältnis und wäre oftmals bereits vorbestraft. Solche prototypischen Kriterien haben jedoch vor allem eine veranschaulichende Funktion und treffen auf viele Einzelfälle nicht zu. Den typischen Deutschland-Dschihadisten gibt es also nicht. Quelle Auch die Psychologie bietet wenig verlässliche Hinweise darauf, ob bestimmte Auffälligkeiten als konkrete Warnsignale für terroristisches Handeln gedeutet werden sollten. Radikalisierung stellt also einen hochkomplexen Prozess dar, der bislang nicht genauer bestimmt werden kann. Quelle
Was tun gegen Radikalisierung?
Repression, Prävention und Intervention – das sind die Schlagworte, die Wissenschaftler und andere Experten islamistischem Extremismus entgegenstellen.Repression Damit sind staatliche Maßnahmengemeint, die den Handlungsspielraum islamistischer Extremisten einschränken sollen. Die FES-Studie empfiehlt in diesem Zusammenhang die Schaffung eines rechtlichen Rahmens, um in Gefängnissen Programme zur Deradikalisierung anbieten zu können – insbesondere in Jugendstrafanstalten, wo Jugendliche gezielt für den IS und salafistische Gruppen rekrutiert werden. Laut dem Ethnologen Werner Schiffauer werden entsprechende Initiativen muslimischer Gemeinden oft von staatlicher Seite zurückgewiesen, weil gegen die jeweilige Gemeinde Vorbehalte bestehen. QuellePrävention Prävention hingegen umfasst alles, was den Einstieg ins radikale Milieu verhindert. Interreligöser Dialog ist hier ebenso wichtig wie die Aufklärung über Extremismus und Terrorismus. Das Schaffen muslimischer Vorbilder, Jugend(sozial)arbeit sowie deutschsprachige Angebote für Muslime im Internet sind weitere wichtige Präventionsmaßnahmen. Ein besonderer Handlungsbedarf besteht derzeit in deutschen Flüchtlingsunterkünften, da der IS hier laut FES-Studie nachweislich versucht, Anhänger zu rekrutieren.QuelleIntervention Intervention verfolgt das langfristige Ziel, bereits radikalisierte Personen zum Ausstieg zu bewegen. Laut Experten sind in der Regel ein bis zwei Jahre nötig, um einen Ausstiegsprozess erfolgreich abzuschließen. Langfristige Förderprogramme für Deradikalisierungsprojekte sind daher ebenso erforderlich wie eine fortdauernde Ausstiegsberatung – sowohl für die Betroffenen selbst als auch für ihre Angehörigen. Solche Programme setzen wiederum eine funktionierende Kooperation mit muslimischen Organisationen voraus.Quellels übergreifende Handlungsempfehlung fordern die Verfasser der FES-Studie mehr Zeit und Geld, um Prozesse von Radikalisierung wissenschaftlich untersuchen zu können. Denn: Je besser diese Prozesse nachvollzogen werden, desto effektiver lassen sie sich verhindern.Von Timo Tonassi