MEDIENDIENST: Sie erforschen derzeit, welche Auswirkungen die Wohnsitzauflage für Geflüchtete auf den Arbeitsmarkt hat. Zu welchen Erkenntnissen sind Sie gelangt?
Herbert Brücker: Wenn Menschen an einem Ort festgehalten werden, ist es für sie schwieriger, sich nach Arbeit umzusehen. Die Informations- und Suchkosten steigen, insbesondere für Jobs, die in weiter entfernten Regionen liegen. Das verringert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Geflüchteter eine passende Stelle findet. Vor diesem Hintergrund ist anzunehmen, dass dort, wo eine Wohnsitzauflage gilt, die Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt langsamer verläuft.
Einige Bundesländer wenden die Wohnsitzauflage so an, dass Geflüchtete nur in bestimmten Landkreisen eine Wohnung suchen dürfen. Was bedeutet das für Geflüchtete?
Zum einen führen Wohnsitzauflagen dazu, dass ein Teil der Geflüchteten zunächst in strukturschwachen Regionen verbleiben muss, in denen die Beschäftigungsaussichten schlecht sind. Zum anderen wurden Geflüchtete häufig auf Regionen verteilt, in denen die Arbeitsmärkte nicht sehr stark diversifiziert sind, das heißt in denen es nur Jobs in wenigen und ganz bestimmten Branchen gibt. Das verringert natürlich die Aussichten, einen Job zu finden. Ein Beispiel: Viele Geflüchtete finden gegenwärtig Arbeit in der Gastronomie. Da sind die formellen Qualifikationsanforderungen häufig recht gering. Das kann in einer Großstadt, in der es viele Restaurants gibt, gut funktionieren. In ländlichen, strukturschwachen Gebieten, wo es vielleicht eine Gaststätte pro Dorf gibt, sind die Chancen viel geringer, einen Job als Kellner oder Küchenhilfe zu finden. Ähnliches gilt aber auch für gut qualifizierte Geflüchtete. Wenn ein Ingenieur in einer Region lebt, in der keine Wirtschaftsbranche existiert, die seine Qualifikation nachfragt, wird er nur schwer einen Job finden. Darum steigen die Beschäftigungschancen in Ballungsräumen mit einer großen Vielfalt von Wirtschaftsaktivitäten und Jobs.
Prof. Dr. Herbert Brücker ist Direktor des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM) und leitet den Forschungsbereich Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). (Foto: Murr)
Doch Geflüchtete können außerhalb ihres Wohnortes nach Jobs suchen und dürfen auch umziehen, wenn sie eine sozialversicherungspflichtige Stelle gefunden haben. Löst das nicht das Problem?
Es ist auch bei den einheimischen Arbeitskräften nicht so, dass die Jobs überwiegend über das Internet oder die Arbeitsvermittlung der Bundesagentur für Arbeit gefunden werden. Sehr viel häufiger über persönliche Kontakte. Das gilt für Geflüchtete und andere Migranten verstärkt. Um eine Arbeit zu finden, muss man mit Menschen sprechen, Informationen sammeln, Kontakte knüpfen. Das kann man nur tun, wenn man vor Ort ist.
Die Bundesregierung rechtfertigt das Gesetz damit, dass Geflüchtete dazu neigen würden, in Ballungsräume zu ziehen und dort geschlossene Communities zu bilden. Das erschwere ihre Integration. Stimmt das?
Es ist zwar falsch, dass sich alle Geflüchteten oder Migranten lieber in Großstädten niederlassen würden. Es wäre aber tatsächlich eine stärkere Konzentration auf Ballungsräume und Großstädte als im Bevölkerungsdurchschnitt zu erwarten. Aus der empirischen Forschung wissen wir: Netzwerke von Menschen mit gleicher Herkunft sind eine sehr wichtige Ressource. In einem Netzwerk ist der Informationsaustausch viel effizienter – und die Jobsuche einfacher. Etwa die Hälfte der Flüchtlinge, die in Deutschland eine Arbeit gefunden haben, haben es durch persönliche Kontakte erreicht. Aus der empirischen Forschung wissen wir auch, dass Jobs, die über persönliche Netzwerke gefunden wurden, mit höheren Verdiensten und einer längeren Beschäftigungsdauer verbunden sind. Es stimmt allerdings, dass eine Konzentration auch negative Aspekte hat. Wer immer in seiner Community unterwegs ist, hat geringere Anreize, die deutsche Sprache zu erlernen. Es sind deshalb bei einer sehr starken Konzentration ein verlangsamter Spracherwerb zu beobachten. Das verringert wiederum die Chancen, einen Job zu finden oder im Arbeitsmarkt aufzusteigen. Man sollte deshalb versuchen, dass durch begleitende Sprachprogramme zu verhindern.
Soll die Bundesregierung die Wohnsitzauflage für Geflüchtete aufgeben?
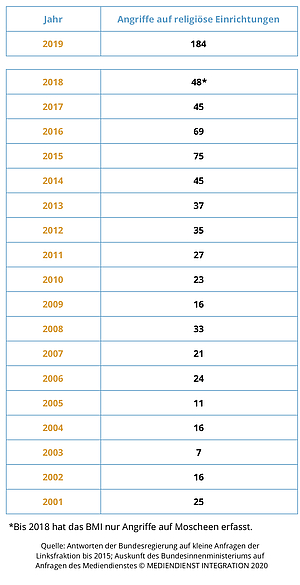
Grundsätzlich ist zu erwarten, dass Mobilität bei der Arbeitsmarktintegration hilft – das gilt auch für einheimische Arbeitskräfte. Wir untersuchen gegenwärtig die Effekte der Wohnsitzauflage und gehen der Frage nach: Wo können Geflüchtete schneller einen Job finden – in einem Bundesland mit oder ohne Wohnsitzauflage? Durch die regionalen Unterschiede in der Anwendung der Wohnsitzauflage und die Beobachtung der Arbeitsmarktintegration vor und nach Einführung der Wohnsitzauflage werden wir die Effekte identifizieren können. Diese Ergebnisse sind erst einmal abzuwarten. Wenn Sie nach meiner persönlichen Erwartung fragen: Ich rechne damit, dass wir auch in Deutschland zu ähnlichen Befunden wie in früheren Studien aus anderen Ländern wie zum Beispiel Schweden kommen werden: Wohnsitzauflagen werden die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten nicht beschleunigen, sondern eher behindern. Wenn sich dies tatsächlich bestätigt, würde das gegen eine Verlängerung der Wohnsitzauflage sprechen.
Wo gilt die Wohnsitzauflage?
Die Wohnsitzauflage (§12a AufenthG) wurde 2016 eingeführt, um die Verteilung von Geflüchteten in Deutschland zu steuern. Demnach müssen Geflüchtete in den ersten drei Jahre der Asylanerkennung im Land wohnen, in das sie zugewiesen wurden. Die Bundesländer können entscheiden, ob die Wohnsitzauflage für das gesamte Bundesland oder für eine bestimmte Kommune gilt ("positive Wohnsitzauflage"). Sie können außerdem bestimmen, dass sich Geflüchtete in bestimmten Landkreisen oder Kommunen nicht niederlassen dürfen (Zuzugssperre). Drei Bundesländer (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen) haben keine Wohnsitzauflage.
Interview: Fabio Ghelli




