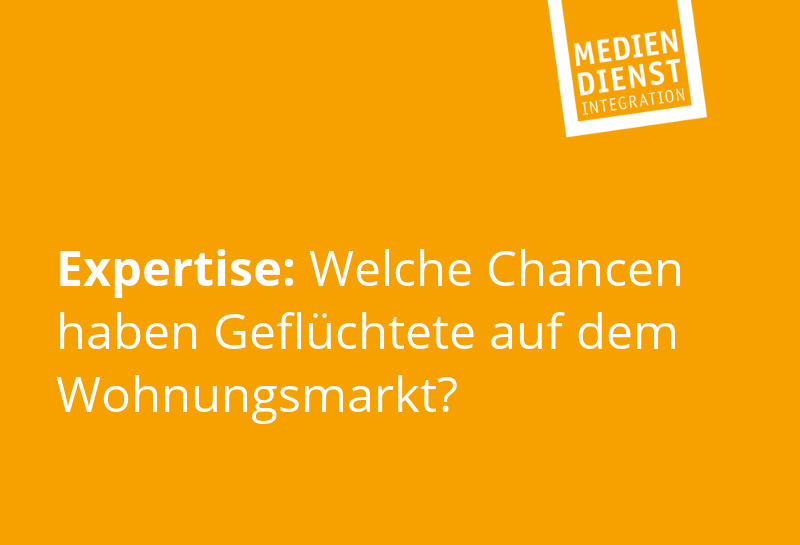Wer als Flüchtling nach Deutschland kommt, muss bis zu sechs Monate in einer Erstaufnahmeeinrichtung leben. Danach werden Geflüchtete meist in Gemeinschaftsunterkünfte verlegt. Wann und unter welchen Bedingungen sie in eine eigene Wohnung ziehen können, ist in den Bundesländern und Kommunen sehr unterschiedlich geregelt.
In einer Studie haben Wissenschaftlerinnen am „Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung“ (BIM) die Situation in Berlin und Dresden untersucht: Welchen Zugang haben Geflüchtete dort zum Wohnungsmarkt? Mit welchen Problemen sind sie bei der Wohnungssuche konfrontiert? Und welche Unterstützungsangebote gibt es? Unter der Leitung von Professorin Naika Foroutan hat das Forscherteam Geflüchtete sowie Vertreter aus Politik, Verwaltung und von Initiativen in beiden Städten befragt. Gefördert wurde die Untersuchung von der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung.
Die vollständige Studie wird am 23. März vorgestellt. In einer EXPERTISE für den MEDIENDIENST stellen die Autorinnen vorab zentrale Ergebnisse vor.
Flüchtlinge sind mit zahlreichen Hürden konfrontiert
Die Expertise zeigt: Sowohl in Berlin als auch in Dresden haben Geflüchtete schlechte Chancen, eine eigene Wohnung zu finden. Das hat unterschiedliche Gründe:
- Rechtliche Hürden: Der Umkreis, in dem Geflüchtete eine Wohnung suchen können, ist stark eingeschränkt. Selbst nach dem Asylverfahren sind viele an das Bundesland gebunden, in dem ihr Verfahren durchgeführt wurde. In Dresden kommt erschwerend hinzu, dass Geflüchtete in der Regel erst eine Wohnung suchen können, wenn ihr Asylantrag bewilligt wurde. In Berlin hingegen ist die Wohnungssuche bereits während des Asylverfahrens möglich.
- Angespannter Wohnungsmarkt: Sowohl in Berlin als auch in Dresden gibt es immer weniger bezahlbaren Wohnraum für Menschen, die ein geringes Einkommen haben oder Transferleistungen beziehen. In Berlin etwa würden fast 275.000 kleine Wohnungen benötigt, um durchschnittlich verdienende Haushalte zu versorgen. Geflüchtete Wohnungsuchende kommen zu diesem Bedarf hinzu.
- Mangelnde Informationen: Viele Flüchtlinge sind nicht darüber informiert, dass sie eine eigene Wohnung beziehen dürfen, und begeben sich daher oft gar nicht erst auf die Suche. In einer Berliner Notunterkunft wurden sogar Falschinformationen verbreitet: Sozialarbeiter sollen Geflüchteten erzählt haben, dass sie erst nach drei Jahren Anspruch auf eine eigene Wohnung hätten.
- Bürokratische Hürden: In Berlin muss ein Wohnungsangebot zunächst durch die Behörden geprüft werden, bevor Geflüchtete dort einziehen können. 2016 dauerte diese Prüfung mehrere Wochen. In der Zwischenzeit war die Wohnung häufig schon an eine andere Partei vermittelt worden. Auch in Dresden erschweren bürokratische Hürden die Wohnungssuche.
- Vorbehalte und Diskriminierung durch die Vermieter: Den befragten Initiativen zufolge haben viele Vermieter Vorbehalte gegenüber Flüchtlingen. Das äußert sich etwa in der Befürchtung, unterschiedliche "Wohnkulturen" könnten zu Problemen beim Zusammenleben führen. Andere Vermieter hätten offen zugegeben, dass sie keine Geflüchteten als Mieter haben wollen.
Wie können Flüchtlinge unterstützt werden?
Die Forscherinnen haben auch untersucht, welche Angebote es gibt, um Flüchtlinge auf dem Wohnungsmarkt zu unterstützen. Das Ergebnis: Sowohl in Berlin als auch in Dresden haben Politik und Verwaltung erste Strategien entwickelt. Diese reichten jedoch bei weitem nicht aus, um den Bedarf an Wohnraum zu decken.
Auch deshalb gebe es zahlreiche Initiativen und Ehrenamtliche, die Geflüchtete bei der Wohnungssuche unterstützen. Ihre Arbeit umfasse jedoch deutlich mehr als nur die Betreuung der Flüchtlinge. Viele Initiativen versuchten, Vermietern Unsicherheiten zu nehmen, vermittelten bei Problemen oder arbeiteten gegen Vorbehalte an. Diese Art der Unterstützung sei sehr betreuungsintensiv und könne daher nicht in ausreichendem Maß angeboten werden, so die Autorinnen der Expertise.
Um den Wohnungsmarktzugang von Flüchtlingen zu verbessern, sehen die Forscherinnen nicht nur Behörden in der Pflicht. Auch Vermieter müssten Maßnahmen ergreifen: Neben interkulturellen Schulungen für ihre Mitarbeiter sollten sie sich um mehr Personal aus Einwandererfamilien bemühen und Mietverträge in verschiedenen Sprachen zur Verfügung stellen.
Von Jennifer Pross
Sie sind Journalist*in und haben weitere Fragen oder suchen Fachleute zum Thema? Dann können Sie uns gern kontaktieren. Wir helfen schnell und unkompliziert. Unsere Texte und Grafiken können kostenfrei unter den Regeln der Creative Commons und unserer Namensnennung verwendet werden. Dies gilt nicht für Bilder und Fotos, die wir von Dritten erworben haben.