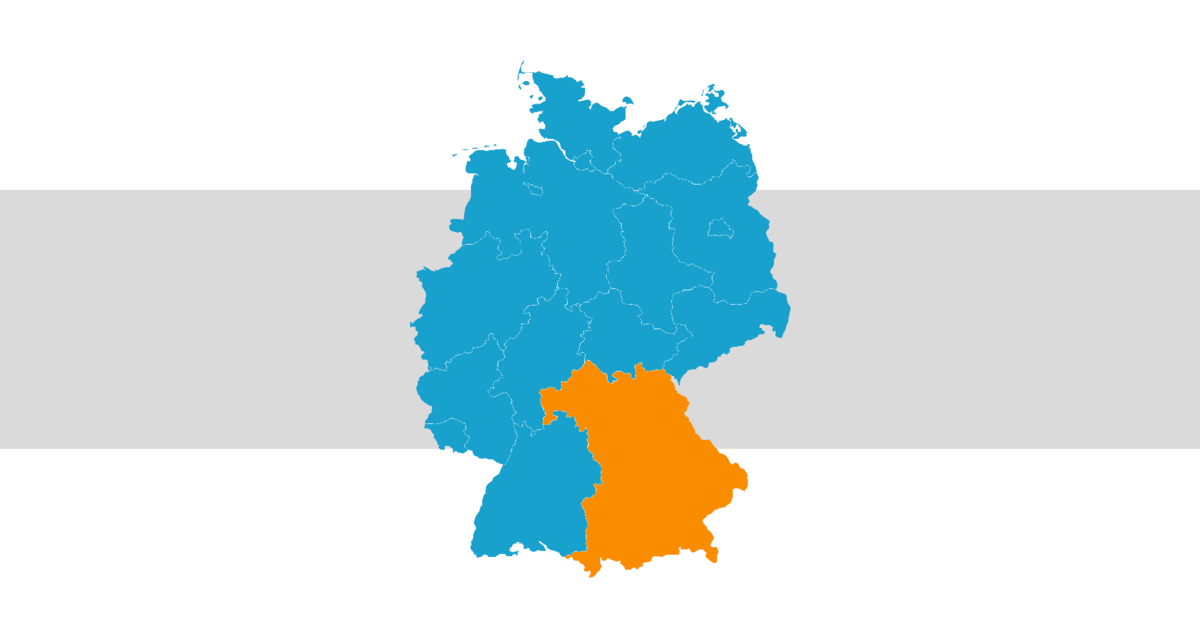Menschen mit Migrationshintergrund haben vielseitige Einstellungen und Prioritäten. Genauso wie Personen ohne Migrationshintergrund können sie sich vorstellen, ein breites Parteien-Spektrum zu wählen – das zeigt eine neue Studie des Deutschen Zentrums für Integration- und Migrationsforschung (DeZIM). "Eine eindeutige Parteipräferenz lässt sich aus der Herkunft oder dem Migrationshintergrund einer Person nicht ableiten", sagt Dr. Friederike Römer, Co-Autorin der Studie bei einem Pressegespräch des Mediendienstes.
Auch innerhalb einzelner Communitys variieren die Parteipräferenzen stark. Dabei spielt Alter eine große Rolle. Das ist der Fall sowohl in der türkeistämmigen als auch in der russischsprachigen Community. "Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion wählten früher eher die CDU, aus Dankbarkeit zu Altkanzler Helmut Kohl, der sich für sie einsetzte", sagt Jannis Panagiotidis, Wissenschaftlicher Geschäftsführer des Forschungszentrums für die Geschichte von Transformationen (RECET) an der Universität Wien. Heutzutage würden sich Wähler*innen in der postsowjetischen Diaspora stärker links und rechts der politischen Mitte orientieren.
Auch unter türkeistämmigen Personen gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Generationen: "Wähler*innen aus früheren Generationen orientierten sich stärker danach, welche Partei sie als Gruppe wahrnahm und sie in Deutschland akzeptierte", sagt Yunus Ulusoy, Programmleiter beim Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZfTI). Derzeit seien Interessen und Prioritäten der Wähler*innen mit Türkei-Bezug in der 2. oder 3. Generation kaum von denen von Wähler*innen ohne Migrationshintergrund zu unterscheiden. Ihre Präferenzen orientieren sich eher nach einzelnen Kandidat*innen und weniger nach Parteien.
Diskriminierung beeinflusst politische Teilhabe
Trotz aller Unterschiede gibt es auch Gemeinsamkeiten unter migrantischen Wähler*innen. Zum Beispiel haben Menschen mit Migrationshintergrund tendenziell weniger Vertrauen in die deutsche Politik. So würden viele Wähler*innen mit Migrationshintergrund den Parteien geringe Lösungskompetenzen zuschreiben – etwa in den Bereichen Migration und Wirtschaft, stellt die DeZIM-Studie fest.
Das könnte unter anderem an Erfahrungen mit Rassismus und Diskriminierung liegen, erklärt Politikwissenschaftler Ulusoy: "Die deutsche Politik im Allgemeinen schafft es nicht, neu Zugewanderten – aber auch Einwanderer*innen, die schon seit vielen Jahren hier leben – ein Gefühl der Zugehörigkeit zu vermitteln". Stattdessen würde sich die öffentliche Diskussion über Migration fast ausschließlich auf die vermeintlichen Defizite von Ausländern fokussieren.
Mehr Sorgen um persönliche Lebenssituation
Allgemein betrachtet unterscheiden sich Wähler*innen mit und ohne Migrationshintergrund nicht signifikant voneinander: "Ob eine Person einen Migrationshintergrund hat oder nicht, Sorgen und Ängste sind vergleichbar", sagt Studien-Autorin Römer. Wenn es um emotionale Themen wie etwa Kriminalität geht, sind Menschen mit Migrationshintergrund empfindlicher – sie fürchten etwa häufiger, im Alltag Opfer von einer Straftat zu werden, stellt die DeZIM-Studie fest. Dabei unterstreicht Römer: „Alle Menschen sind von Kriminalität oder Terror betroffen. Allerdings wird in der öffentlichen Diskussion seltener anerkannt, dass Menschen mit Migrationshintergrund auch diese Sorgen haben".
Von Alma Beck Chacón
Sie sind Journalist*in und haben weitere Fragen oder suchen Fachleute zum Thema? Dann können Sie uns gern kontaktieren. Wir helfen schnell und unkompliziert. Unsere Texte und Grafiken können kostenfrei unter den Regeln der Creative Commons und unserer Namensnennung verwendet werden. Dies gilt nicht für Bilder und Fotos, die wir von Dritten erworben haben.