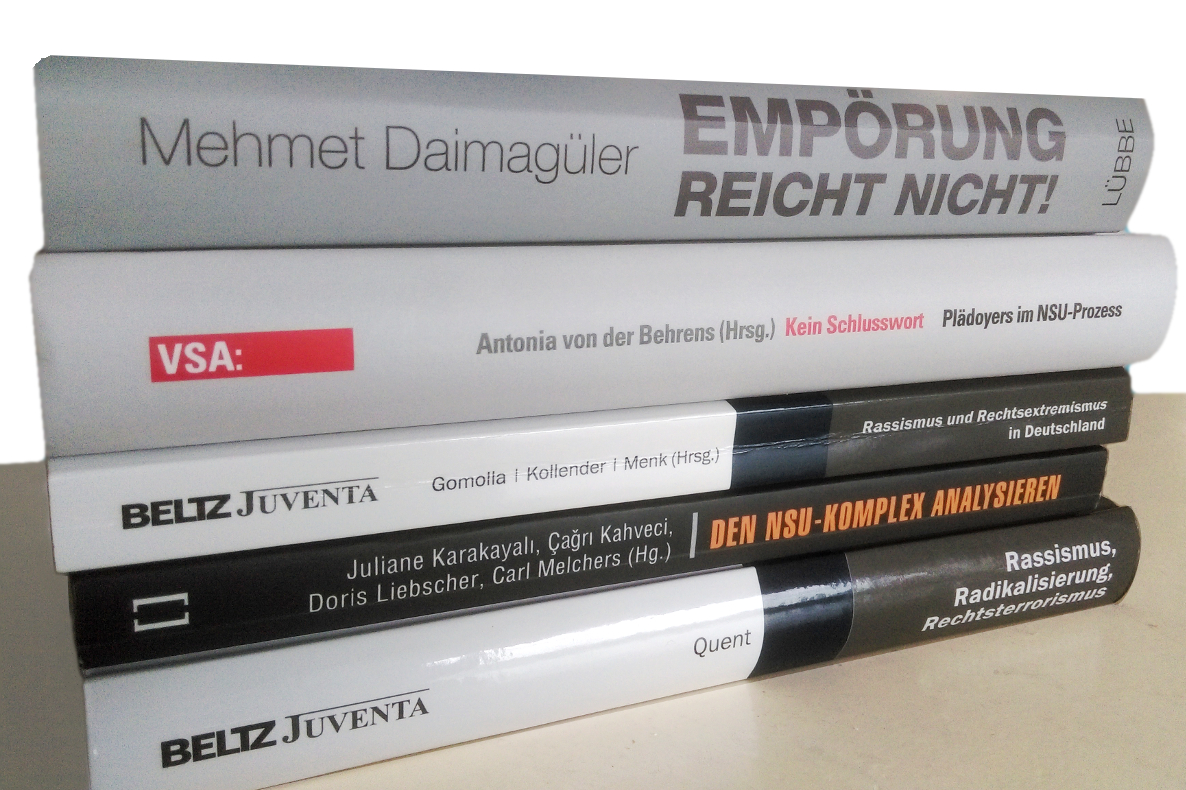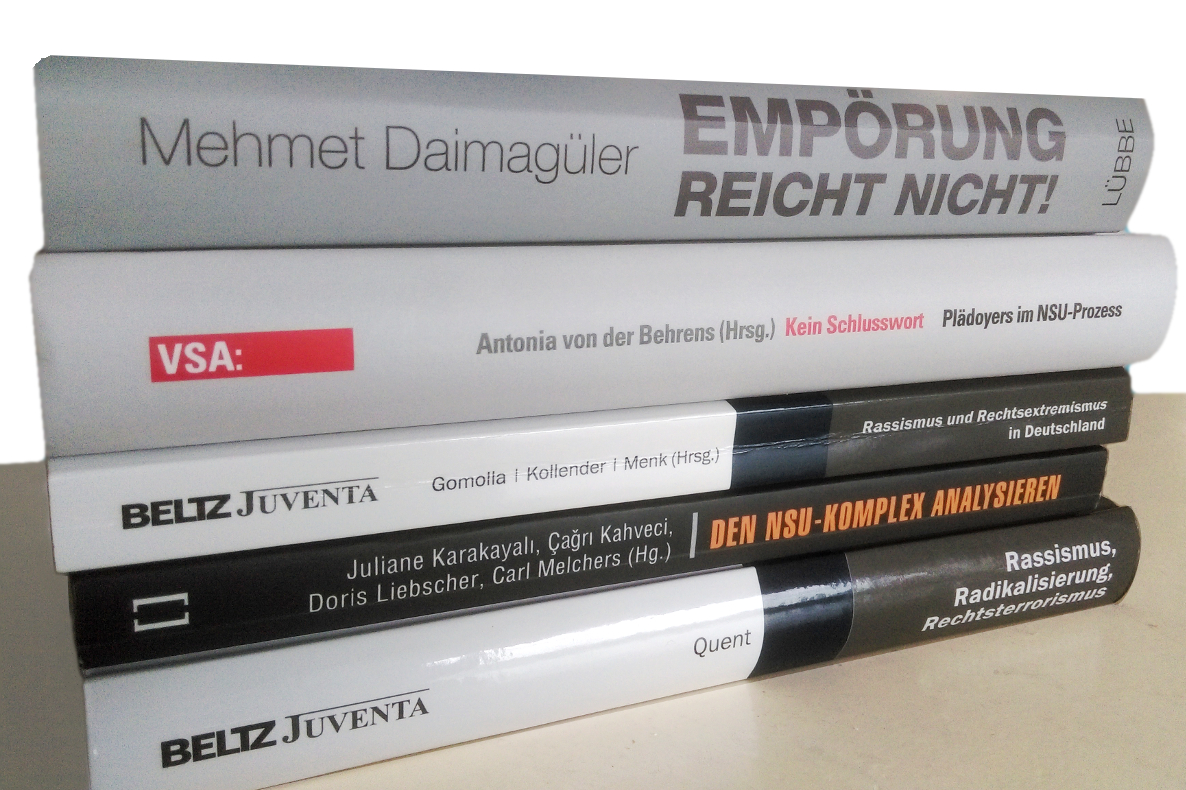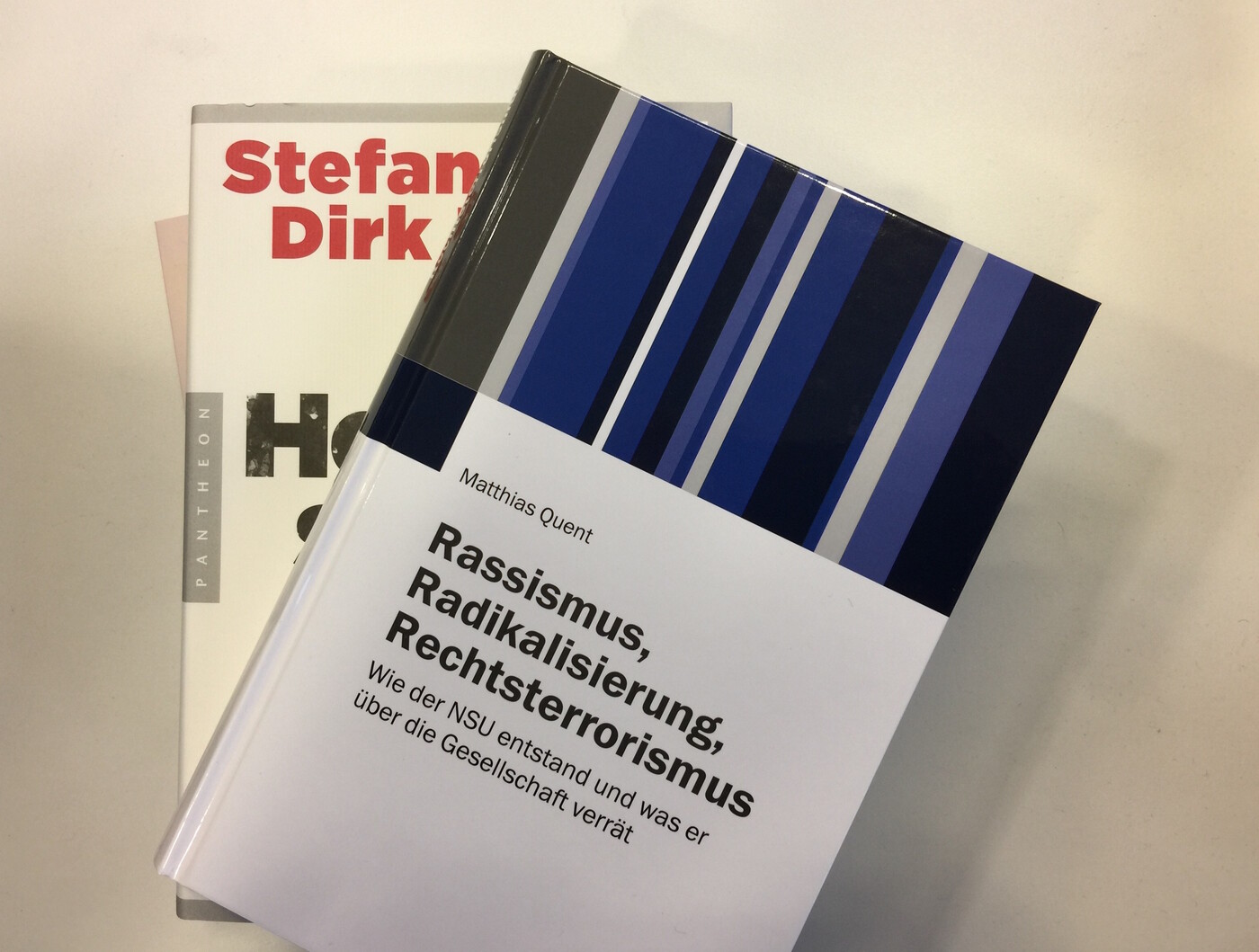Vor fünf Jahren begann der Prozess gegen das rechtsterroristische Netzwerk "Nationalsozialistischer Untergrund". Vieles ist nach wie vor unaufgeklärt: Wie konnte der NSU entstehen? Welche Rolle spielten Verfassungsschutz und Polizei? Warum wurde das staatliche Mitverschulden bisher kaum untersucht? Diesen Fragen gehen verschiedene Neuerscheinungen nach.
„Den NSU Komplex analysieren“, J. Karakayali, Ç. Kahveci, D. Liebscher, C. Melchers (Hrsg.) (2017) Warum hat die Forschung bislang so wenig zum Verständnis des NSU-Komplexes beigetragen? Dieser Frage geht der Sammelband „Den NSU-Komplex analysieren“ nach. Der Band wurde von der Rassismusforscherin Juliane Karakayali und anderen Wissenschaftlern herausgegeben. Dass Medien die Opfer des NSU über Jahre hinweg ignorierten, kritisieren die Kommunikationswissenschaftlerin Johanna Schaffer und die Sozialpädagogin Ayşe Güleç in ihrem Beitrag. Sie zeigen auf, dass die Familien der Opfer Strategien entwickelten, um sich dennoch Gehör zu verschaffen und Rassismus immer wieder zu thematisieren. Der Autor Heiner Busch stellt fest: Trotz seiner undurchsichtigen Rolle im NSU-Komplex ist der Verfassungsschutz gestärkt aus der „Niederlage“ hervorgegangen. Statt einer stärkeren Reglementierung seien die finanziellen und personellen Mittel sogar erhöht worden.#1988#„Rassismus und Rechtsextremismus in Deutschland“, M. Gomolla, E. Kollender, M. Menk (Hrsg.) (2018) Im Sammelband „Rassismus und Rechtsextremismus in Deutschland“ setzen sich Wissenschaftler mit der Entstehung des NSU auseinander und fragen danach, wo Präventionsstrategien ansetzen können. Orientierungslosigkeit im Osten nach der Wende, das Erstarken der "Republikaner" im Westen und die Migrationsdebatte hätten zu pogromartigen Ausschreitungen geführt. Aus diesem "Bodensatz" sei der NSU entstanden, erklärt der Soziologe Matthias Quent in seinem Beitrag. Die Aufarbeitung des rassistischen Terrors stehe laut Quent noch am Anfang. Wie dringend sie aber sei, hätten zum Beispiel die flüchtlingsfeindlichen Übergriffe der vergangenen Jahre gezeigt. Die Erziehungswissenschaftlerin Mechtild Gomolla untersucht, wie sich Schulen vor dem Hintergrund des NSU-Komplex verändern müssen, um Diskriminierung und Rassismus etwas entgegenzusetzen.
Plädoyers der Nebenklage und von Angehörigen
„Kein Schlusswort“, A. von der Behrens (Hrsg.) (2017) In dem
Buch „Kein Schlusswort“ sind zwölf Plädoyers abgedruckt, die 2017 im NSU-Verfahren gehalten wurden. Es sind Plädoyers der Nebenklage-Anwälte, aber auch von Betroffenen und Hinterbliebenen der Mordserie. Ihre Kritik: Ein „staatliches Mitverschulden“ wurde bislang kaum untersucht. Und auch die These vom „Terror-Trio“ zweifeln sie an. Vielmehr hätte sich hinter den Tätern ein größeres Unterstützer-Netzwerk gezeigt, gegen das die Bundesanwaltschaft bislang kaum ermittelt habe. In ihrem mehr als 100-seitigen Plädoyer gibt die Nebenklage-Anwältin und Herausgeberin des Buches, Antonia von der Behrens, einen detaillierten Überblick über die Erkenntnisse aus den Verhandlungen und die Lücken im NSU-Verfahren.
„Empörung reicht nicht“, M. Daimagüler (2017) Wie groß war oder ist der NSU wirklich? Welche Rolle spielten V-Leute des Verfassungsschutzes? Haben Polizeibehörden in die falsche Richtung ermittelt, weil ihre Mitarbeiter teils rassistisch eingestellt waren? Fragen, denen der Nebenklage-Anwalt Mehmet Daimagüler in seinem
Plädoyer „Empörung reicht nicht“ nachgeht. Neben diesen Fragen thematisiert er aber auch, was der NSU mit jedem Einzelnen zu tun hat: Der NSU – das klinge für viele weit weg. Doch immer noch sei eine Debatte über Rassismus in der Gesellschaft notwendig und die gehe jeden etwas an.
Zu den Hintergründen
„Unter Sachsen“, H. Kleffner, M. Meisner (Hrsg.) (2017) Kein Buch über den NSU. Aber ein
Buch zu dem Umfeld, in dem er unentdeckt bleiben konnte. Mehr als 40 Autoren schreiben darüber, wie rassistische Gewalt in Sachsen über Jahre verharmlost wurde und wie Pegida oder die AfD sich entwickelten. Gesammelt wurden die Analysen, Interviews, literarischen Texte und persönlichen Kommentare von Heike Kleffner (Journalistin und wissenschaftliche Mitarbeiterin der LINKEN) und Matthias Meisner (Redaktuer beim Tagesspiegel).
"Unter den Teppich gekehrt", Kulturbüro Sachsen (Hrsg.) (2017)Weitere Informationen darüber, wer den NSU in Sachsen unterstützte, finden sich in der
Broschüre: „Unter den Teppich gekehrt. Das Unterstützungsnetzwerk des NSU in Sachsen“. Für die Broschüre, die online bestellt werden kann, hat das Kulturbüro Sachsen bisherige Erkenntnisse aus Gerichtsprozessen und Untersuchungsausschüssen gesammelt.
Zusammenstellung: Carsten Janke und Lea Hoffmann