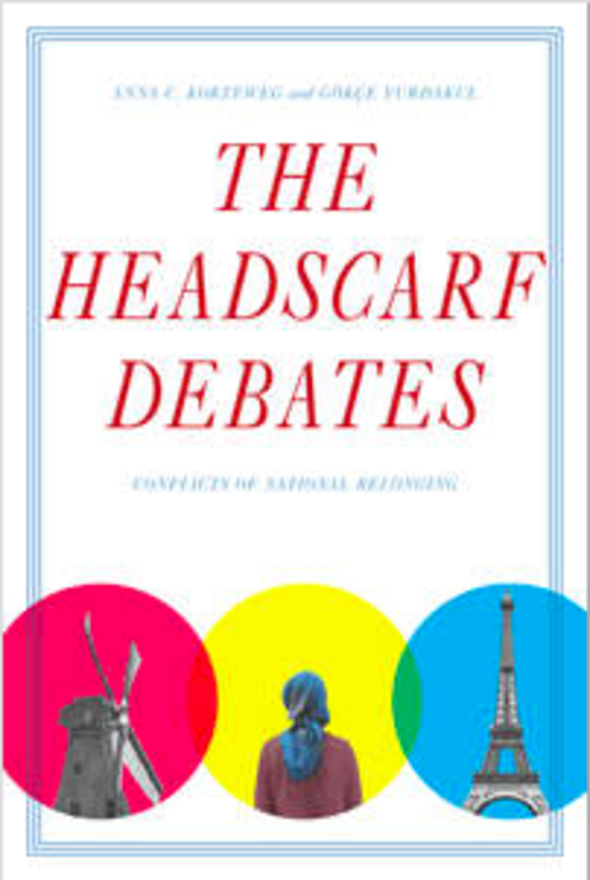Vor Kurzem hat das Bundesverfassungsgericht per Beschluss erklärt: Ein pauschales Kopftuch-Verbot für Lehrerinnen an öffentlichen Schulen ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Religiöse Bekundungen "durch das äußere Erscheinungsbild von Pädagoginnen und Pädagogen" zu verbieten widerspreche der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit sowie dem Diskriminierungsverbot so die Richter aus Karlsruhe. Damit revidierten sie ihr Urteil von 2003. Viele Bundesländer werden ihre Gesetze nachjustieren müssen. Kritiker sehen durch die Entscheidung das religiöse Neutralitätsgebot des Staates verletzt. So äußerte etwa der Bundesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, gegenüber dem ZDF: Er sehe es als Verstoß gegen die Neutralitätspflicht, wenn Lehrerinnen im Unterricht ein Kopftuch tragen. Und die ZEIT-Journalistin Iris Radisch argumentierte auf der Titelseite : "Die Glaubensfreiheit der Lehrerinnnen wiegt neuerdings schwerer als die Idee von der Neutralität der staatlichen Schule".Wie aber kann man die Pflicht des Staates, sich Religionen gegenüber neutral zu verhalten, mit dem individuellen Recht auf freie Ausübung und Gleichbehandlung der Religionen in Einklang bringen? Mit anderen Worten: Wie neutral muss der Staat sein?Übersehen wird oft, dass Deutschland kein laizistisches Land ist, wie etwa Frankreich oder die Türkei wo Staat und Religion laut Verfassung strikt voneinander getrennt sind. Im deutschen Grundgesetz ist eine solche Trennung jedoch nicht vorgesehen. In Artikel 4 des Grundgesetzes sind lediglich säkulare Prinzipien wie Religionsfreiheit und Neutralitätsgebot verankert. Der Staat gewährt seinen Bürgern individuelle Religionsfreiheit. Niemand darf gezwungen werden, einen bestimmten Glauben anzunehmen oder aufzugeben ("negative Religionsfreiheit"). Und jeder hat das Recht, seine Religion im Rahmen der staatlichen Ordnung auszuleben ("positive Religionsfreiheit"). Zudem sollte ein säkularer Staat möglichst allen Religionen und Weltanschauungen gegenüber neutral sein und keine Religion bevorzugen oder benachteiligen.Quelle
Was bedeutet "Deutschland ist säkular"?
Diese religiöse und weltanschauliche Neutralität ist in Deutschland nicht mit einer "Verbannung religiöser Symbole" gleichzusetzen. In einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2003 zum Fall Fereshta Ludin wird sie vielmehr als "die Glaubensfreiheit für alle Bekenntnisse gleichermaßen fördernde Haltung" beschrieben. Zudem ist der Säkularismus kein starres Prinzip, sondern birgt eine gewisse Offenheit – Kritiker würden vielleicht auch sagen "Anfälligkeit" – für Verhandlungsprozesse. Der französische Historiker und Soziologe Jean Baubérot erläutert gegenüber dem MEDIENDIENST"Die Säkularität entspringt aus dem Prozess der Säkularisierung, also daraus, dass die Gesellschaft sich nicht mehr nach religiösen Kriterien definiert und viele sich von Religion distanzieren. Diese Distanzierung ist aber eine persönliche Angelegenheit. Laizität dagegen kann die allgemeingültigen Regeln verkörpern. Sie stellt eine politische Ordnung dar, Säkularisierung dagegen eine gesellschaftliche Dynamik."In laizistischen Staaten werden alle religiösen Symbole und Weltanschauungen aus öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Gerichtssälen und Amtsstuben herausgehalten. Es gibt weltweit jedoch nur wenige Länder, die streng laizistisch ausgerichtet sind. Dazu gehören Frankreich und einige afrikanische Staaten wie Mali oder Burkina Faso. Auch die Türkei ist laut Verfassung laizistisch. Unter der Regierung von Recep Tayyip Erdogan wurden die Regelungen jedoch aufgeweicht .In Deutschland sind solche an Laizität orientierten Neutralitätsgesetze für öffentliche Amtsträger nur in Bremennd Berlin zu finden. Möglich geworden war die unterschiedliche Handhabung in einzelnen Bundesländern durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 2003: Demnach könne einer Lehrerin das Tragen eines Kopftuchs an einer öffentlichen Schule nicht untersagt werden, solange es keine entsprechenden Gesetze auf Landesebene gebe. So dürfen in der Hauptstadt bereits seit 2005 weder Lehrer noch Erzieher, Polizei- oder Justizvollzugsbeamte religiöse Symbole wie Kopftuch, Kruzifix oder Kippa tragen. In sechs Bundesländerningegen bestehen Regelungen, die das Kopftuch verbieten, die "Darstellung christlicher und abendländischer Bildungs- und Kulturwerte oder Traditionen" jedoch ausdrücklich zulassen. In den übrigen acht Ländernibt es keine entsprechenden Regelungen."Der Staat gibt sich einerseits neutral, andererseits wird in der Praxis die christliche Religion bevorzugt", sagt der Rechtswissenschaftler Michael Wrase vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Er hält die Karlsruher Entscheidung für einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu religiöser Vielfalt und Gleichberechtigung an Schulen. Auch für die Juristin und Politikwissenschaftlerin Sabine Berghahn hat das Bundesverfassungsgericht konsequent entschieden. Denn eine wirkliche Gleichbehandlung der Religionen finde bisher nicht statt: "Die religiöse Neutralität des Staates bedeutet, dass er sich nicht mit einer Religion oder auch der Abwesenheit von Religion identifizieren darf. Wir haben aber Regularien, die nicht wirklich neutral sind." So hätten etwa die evangelische und katholische Kirche einen staatskirchenähnlichen Status und besondere Privilegien
Würde mehr Laizität zu mehr Gerechtigkeit führen?
Auch die Sozialwissenschaftlerin Gökce Yurdakul von der Berliner Humboldt-Universität begrüßt die Entscheidung aus Karlsruhe und weist bei einem Experten-Gespräch des MEDIENDIENSTES auf Widersprüche beim staatlichen Handeln hin: Einerseits könnten einzelne Bundesländer Kopftuch tragende Musliminnen von Positionen in Schulen, Kitas und anderen öffentlichen Einrichtungen ausschließen. Andererseits gehe der Staat mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) gegen ihre Diskriminierung auf dem privaten Arbeitsmarkt vor. Kirchliche Arbeitgeber seien jedoch davon ausgenommen. Seit einigen Jahren wird auch diskutiert, ob Deutschland sich laizistisch ausrichten sollte, um der wachsenden Vielfalt religiöser und weltanschaulicher Überzeugungen zu begegnen. Der Historiker Baubérot plädiert dafür: "Die Politik sollte immer zukunftsorientiert sein. Die steigende Zahl der praktizierenden Religionen in Deutschland auf der einen Seite und die wachsende Zahl derjenigen, die nicht religiös sind, auf der anderen Seite, machen Überlegungen zu einer gewissen Laizität in Deutschland zwangsläufig notwendig."Baubérot räumt jedoch ein: Auch der Laizismus lasse Spielraum für die Ungleichbehandlung bestimmter Religionen. So werde er in Frankreich dem Katholizismus gegenüber großzügiger ausgelegt als gegenüber dem Islam. Die Rechtwissenschaftlerin Berghahn glaubt ebenfalls nicht, dass mehr Laizität zwangsläufig zu mehr religiöser Gleichberechtigung führt: "Sie kann zur Folge haben, dass gläubige Muslime oder Angehörige anderer Religionen mehr diskriminiert werden, als säkularisierte Christen. Das zeigt sich in Frankreich zum Beispiel am Verbot von Burkaund Niqabm öffentlichen Raum."Von Rana Göroğlu