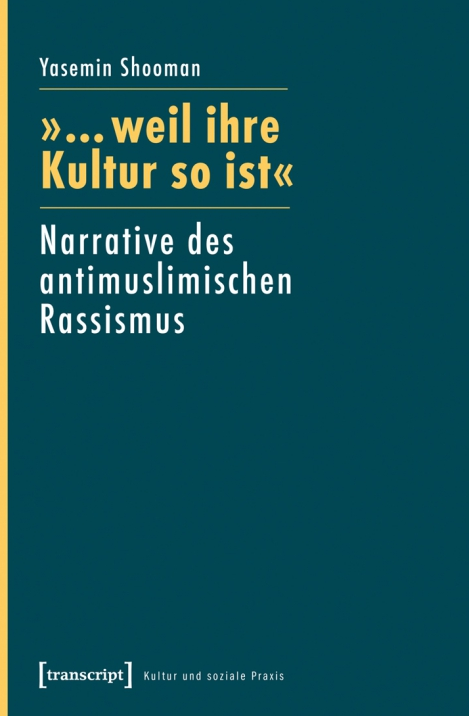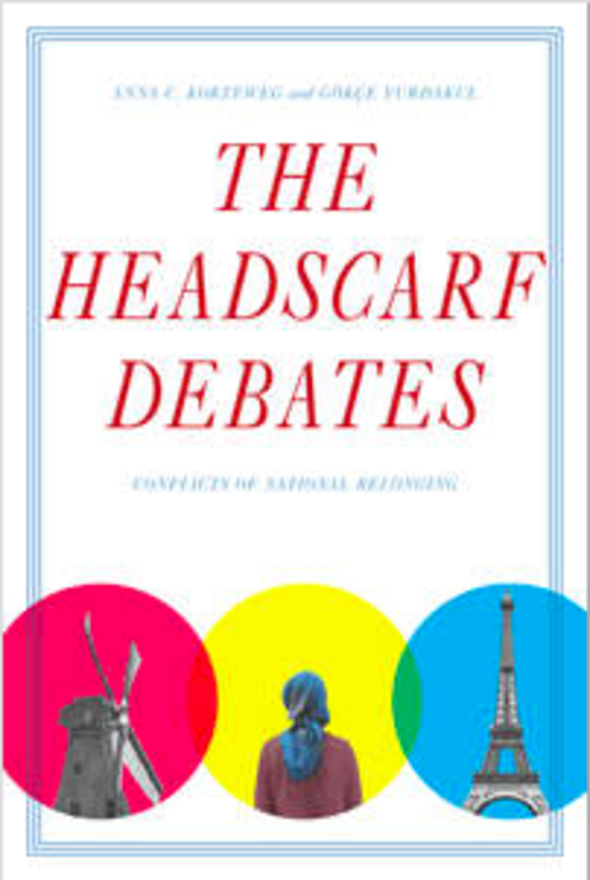In einem Interview, das der ehemalige Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin 2009 der Zeitschrift "Lettre Internnational" gab, sagte er: "Es ist ein Skandal, wenn türkische Jungen nicht auf weibliche Lehrer hören, weil ihre Kultur so ist." Der Titel von Yasemin Shoomans zweitem Buch ist an dieses Zitat angelehnt und greift zurück auf Sarrazins Thesen, die er ein Jahr später mit dem Buch "Deutschland schafft sich ab" veröffentlichte. In dem Bestseller vertritt er unzählige antimuslimische Vorurteile. So schaffe sich Deutschland unter anderem deshalb ab, weil die Zahl der Muslime stark steige. Als "muslimische Migranten" definiert er dabei alle Menschen mit einem Migrationshintergrund aus Bosnien-Herzegowina, der Türkei, dem Nahen- und Mittleren Osten sowie aus Afrika. Welcher Logik folgen solche weit verbreiteten antimuslimischen Diskurse und Narrative Welche Funktion erfüllen pauschale Abwertungen? Und inwiefern können sie als aktuelle Form des Rassismus eingeordnet werden? Diese Fragen stehen im Zentrum der Analyse Shoomans unter dem Titel "»... weil ihre Kultur so ist« Narrative des antimuslimischen Rassismus". Das Buch ist die überarbeitete Fassung ihrer Dissertation am Zentrum für Antisemitismusforschung (ZfA) der Technischen Universität Berlin. Darin hat sie neben populären Sachbüchern von Autoren wie Thilo Sarrazin, Necla Kelek und Peter Scholl-Latour auch Artikel verschiedener Printmedien und islamfeindliche Internetseiten sowie Zuschriften an muslimische Verbände und die Türkische Gemeinde in Deutschland ausgewertet. Die umfassende Analyse schärft den Blick für Islam-Debatten und enttarnt die inneren Wiedersprüche rassistischer Konstrukte.
Ethnisierung der Muslime: Wer sind "die Anderen"?
Shooman zufolge wird im antimuslimischen wie auch in anderen Diskursen verhandelt, was als "wahr" und "unwahr", als "sagbar" und "unsagbar" gilt. Zudem werden "Ein- und Ausschlüsse innerhalb der Gesellschaft" abgesteckt, also die Frage, wer dazugehört und wer nicht. Die Analyse solcher Debatten sei deshalb so wichtig, weil sie nicht nur die Einstellungen gegenüber Minderheiten beeinflussen, sondern auch diskriminierendes Handeln nach sich ziehen und rechtfertigen können. Unter Bezugnahme auf Birgit Rommelsbacher erklärt Shooman: Rassismus werde oftmals als "Legitimationslegende" verstanden, die die Ungleichbehandlung von Menschen "rational" zu erklären versucht, obwohl die Gesellschaft von der prinzipiellen Gleichheit aller Menschen vor dem Recht ausgeht. Von diesem Widerspruch seien viele rassistische Denkmuster geprägt.Quelle859#Zudem zeigt Shooman, dass in den Debatten der vergangenen Jahre folgendes abzulesen ist: Wurden Muslime historisch in europäischen Gesellschaften lange als "äußerer Feind" wahrgenommen, seien sie infolge der Einwanderungsprozesse zu "inneren Feinden" und den "Anderen" oder "Fremden" geworden. Dabei haben Muslime die Rolle für Gruppen eingenommen, die früher als "Gastarbeiter", "Ausländer" und schließlich als "Migranten" oder "Menschen mit Migrationshintergrund" bezeichnet wurden und immer dann im Zentrum standen, wenn es um "Zugehörigkeit" oder "Integrationsprobleme" ging. Wie Yasemin Shooman sprechen deshalb viele Wissenschaftler von einer "Ethnisierung" oder gar "Rassifizierung" der – vermeintlichen oder tatsächlichen – muslimischen Religionszugehörigkeit. Deshalb spricht sie von "antimuslimischem Rassismus".
Die Vereinnahmung des Jüdischen gegen Rassismusvorwürfe
Dass es bei diesen Debatten immer auch darum geht, eine eigene – vermeintlich "deutsche" – Identität zu rekonstruieren, zeigt Shooman anhand zahlreicher Beispiele. So etwa in der erneuten "Leitkultur-Debatte", die 2010 entbrannte, als der damalige Bundespräsident Christian Wulff äußerte, dass "der Islam inzwischen auch zu Deutschland" gehöre. Hans-Peter Friedrich, damals Vorsitzender der CSU-Landesgruppe, entgegnete: "Die Leitkultur in Deutschland ist die christlich-jüdisch-abendländische Kultur. Sie ist nicht die islamische (...) und wird es auch nicht in Zukunft sein. (...) Dass der Islam Teil unserer Kultur ist, unterschreibe ich nicht." Der CDU/CSU-Fraktionschef Volker Kauder schloss sich an: "Das auf unser christlich-jüdischen Tradition beruhende Grundgesetz kann durch nichts relativiert werden, schon gar nicht durch einen Islam, der die Scharia vertritt und zur Unterdrückung der Frauen führt." Selbst Angela Merkel sagte, dass in Deutschland ganz eindeutig das Grundgesetz gelte und nicht die Scharia.QuelleSolche Äußerungen, die den Islam als rückständig, minderwertig und gegensätzlich mit der "aufgeklärten, westlichen Kultur" erscheinen lassen, prägen Shooman zufolge in vielen europäischen Ländern die antimuslimischen Narrative. Aber nicht nur Muslime erscheinen als gleichförmiger Block, auch die "Leitkultur" suggeriere eine (nicht vorhandene) Homogenität der Mehrheitsbevölkerung. Die Beschwörung einer "Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende alten jüdisch-christlichen Tradition" ist dabei ein neues Phänomen. Es ist entlarvend konstruiert, da es geschichtliche Brüche, religiöse und später rassistische Verfolgungen und die Shoa einfach ausblendet. Perfiderweise könnte die Vereinnahmung des Jüdischen in das Konstrukt "christliches Abendland" sogar eine Strategie zur Abwehr des Rassismusvorwurfs sein, so Shooman. Quelleolche Argumentationsmuster entdeckt Shooman auch bei vielen der über 650 Briefe und E-Mails an muslimische Verbände und die säkulare Türkische Gemeinde in Deutschland (TGD), die sie analysiert hat. So wird in einer Zuschrift an die Islamische Gemeinde Millî Görüş (IGMG) vom Januar 2010 gar ein "europäisch-westlich-atheistisch-christlich-jüdisches Volk" konstruiert und Muslime werden als "Ethnie" bezeichnet. Eine identische E-Mail erhielten auch der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) und die TGD, in der es heißt: "Leider ist das Verhalten der Moslems in Deutschland so verabscheuungswürdig, dass sie im Gegensatz zu allen anderen Ethnien, die hier einwandern, die nicht so kriminell, aggressiv und anpassungsfeindlich sind, immer mehr Ablehnung, ja Hass im Gastland erzeugen".Quelleen Empfängern wird oft sowohl das Deutschsein als auch das Mitspracherecht abgesprochen. Sie seien nur Gäste und sollten sich deshalb zurückhalten. Diese Argumentationslinien sind laut Shooman typisch für antimuslimischen Rassismus. "Ein Teil der Konflikte (...) lässt sich jedoch auch durch eine voranschreitende gesellschaftliche Partizipation von Musliminnen und Muslimen erklären. Dies erscheint zunächst paradox, da einer der Hauptvorwürfe an Muslime ihr vermeintlicher Mangel an Integration ist", schreibt Shooman. Doch Partizipation rufe auch "Dominanzkonflikte" hervor, weshalb Muslime immer wieder auf einen niederen gesellschaftlichen Rang verwiesen würden.Von Rana Göroğlu