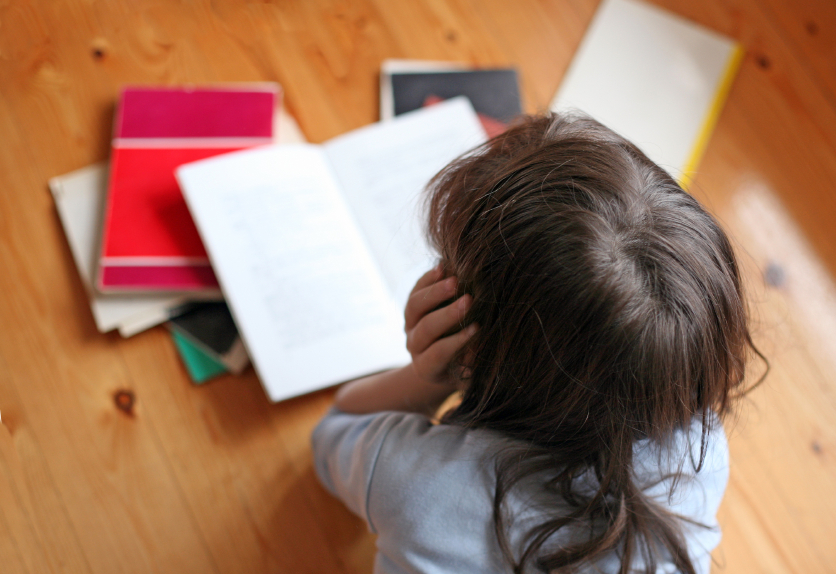Weltweit wächst etwa die Hälfte aller Menschen mit zwei oder mehr Sprachen auf. Damit stellt Mehrsprachigkeit nicht etwa eine Ausnahme, sondern den Normalfall dar. Der Europäischen Union ist dies bewusst – in ihrer "Rahmenstrategie für Mehrsprachigkeit" erklärt sie die Förderung von Mehrsprachigkeit zu ihren Zielen: Alle Bürgerinnen und Bürger sollen „zusätzlich zu ihrer Muttersprache über praktische Kenntnisse in mindestens zwei weiteren Sprachen verfügen“, denn in modernen Gesellschaften ist Mehrsprachigkeit eine wertvolle Ressource.Vielfalt, auch sprachliche Vielfalt, gehört zu den Stärken moderner Gesellschaften.Auch Deutschland ist ein mehrsprachiges Land. Neben einer Fülle unterschiedlicher Herkunftssprachen haben wir acht geschützte Minderheitensprachen, unter anderem Sorbisch, Nordfriesisch, Romani und Niederfränkisch. 1992 trat Deutschland der „Europäischen Chartader Regional- oder Minderheitensprachen“ bei, in der sich die Unterzeichner dazu verpflichten „Praktiken entgegenzutreten, die den Gebrauch von Regional- oder Minderheitensprachen im Zusammenhang mit wirtschaftlichen oder sozialen Tätigkeiten behindern sollen“. Und dass Sprachen im Ausland, jedenfalls die deutsche Sprache im Ausland, geschützt werden sollten, führt die CSU sogar in ihrem eigenen Grundsatzprogramm auf.#872#Für die Förderung von Mehrsprachigkeit gibt es auch gute Gründe. Mehrsprachigkeit führt nicht nur zu größerer geistiger Flexibilität und dem besseren Verständnis beim Erwerb weiterer Sprachen, auch bleiben Mehrsprachige im Alter länger geistig fit. Neben diesen Vorteilen erweitert sprachliche Vielfalt auch das kompetente gesellschaftliche Handeln, denn Sprache ist nicht nur Schriftsprache. Und Vielfalt stärkt eine Gesellschaft – auch Dialekte, Stile und Jugendsprachen haben eine Funktion und eine Berechtigung und folgen bestimmten Regeln. Das weiß übrigens auch die CSU und setzt sich entsprechend für die Förderung des Bairischen an den Schulen des Freistaates ein.Deutschkenntnisse werden im täglichen Miteinander erworben, formelle Schriftsprache in Kindergarten und Schule. Um Kompetenzen in der Schriftsprache zu vermitteln, ist eine sinnvolle Förderung aller Kinder nötig – unabhängig davon, aus welchen sozialen Schichten sie kommen und welche Sprachen sie sprechen. Diese Förderung geschieht in der Schule – wo sonst?In diesem Bereich ist noch viel zu tun – hier stimmen wir der CSU zu. Aber selbst hier ist Zwang zur Einsprachigkeit nicht förderlich, sondern hinderlich: Er verhindert, dass Mehrsprachige ihr Wissen, das sich aus mehr als einer Sprache schöpft, nutzen.
Eine weitere Erklärung zu den Sprachvorschlägen der CSU haben Prof. Dr. Juliana Goschler und Dr. Susanne Grassmann verfasst, die über 40 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unterzeichnet haben. Darin heißt es unter anderem: "Zweisprachigkeit ist – auch schon im frühesten Kindesalter – unproblematisch und kann unter guten Bedingungen sogar positive Effekte auf die gesamte kognitive Entwicklung haben."