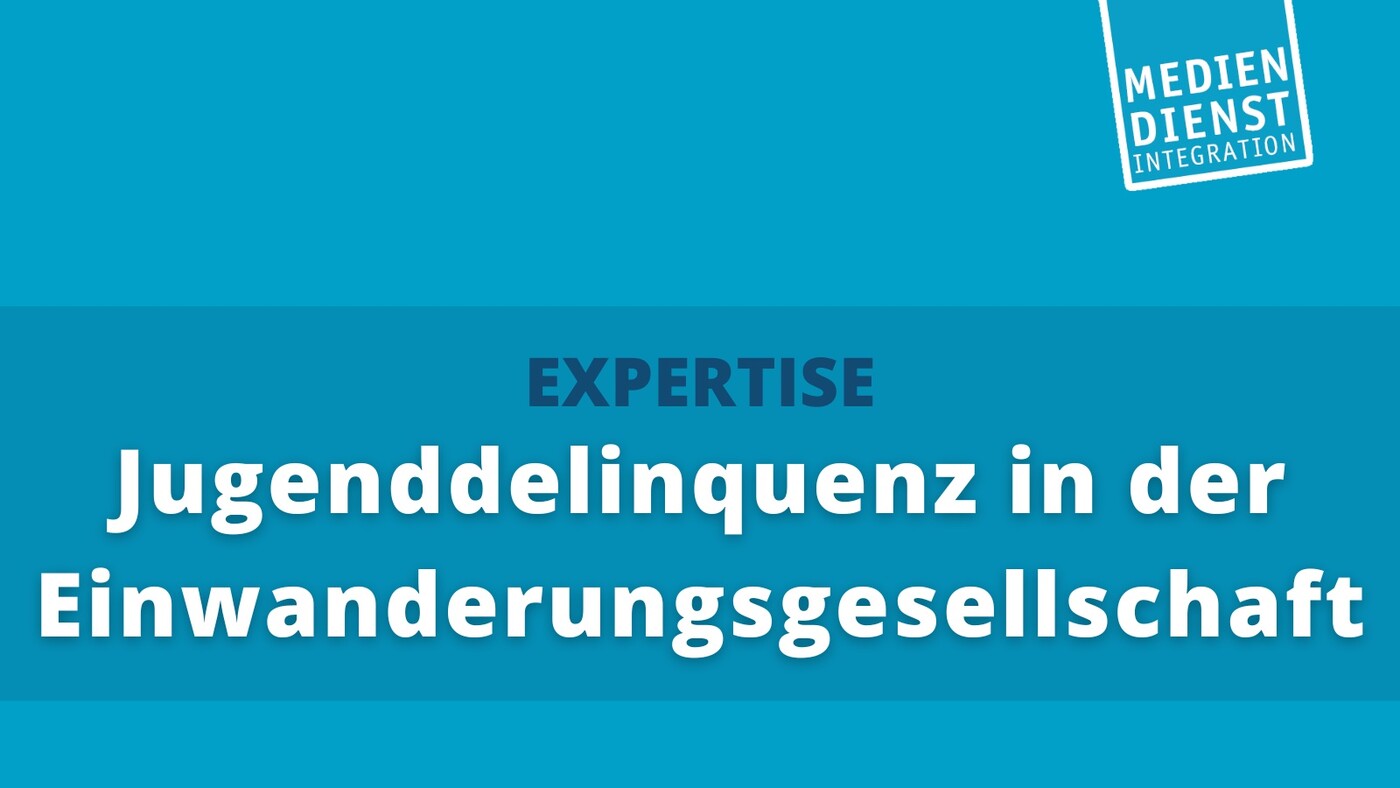Krawalle an Silvester, Delikte in Schwimmbädern und Ausschreitungen in Innenstädten: Immer wieder wird diskutiert, ob Jugendkriminalität und Ausschreitungen zunehmen; die Herkunft der Jugendlichen steht dabei oft im Mittelpunkt. Der Kriminologe Christian Walburg von der Universität Münster hat eine Expertise für den MEDIENDIENST zum Thema erstellt und zeigt: Delinquentes Verhalten unter Jugendlichen ist in den letzten 20 Jahren stark zurückgegangen, zuletzt aber wieder etwas angestiegen. Krawalle seien aber kein neues Phänomen.
Die vollständige Expertise finden Sie hier als PDF.
Jugenddelinquenz ist in Teilen normal – und stark zurückgegangen
Viele Jugendliche begehen irgendwann eine Straftat. In gewissem Maß ist das normal, sie wollen etwa Grenzen austesten. Meist begehen sie leichte Delikte wie Sachbeschädigungen. Ab 16 bis 17 Jahren machen sie das bereits deutlich seltener, und mit Mitte bis Ende 20 verhalten sich nur noch wenige kriminell. Ein kleiner Teil der Jugendlichen – etwa 5 bis 7 Prozent – begehen öfter, teils auch schwere Delikte.
Um sich Kriminalität unter Jugendlichen anzusehen, helfen zwei Quellen: Zum einen die Polizeiliche Kriminalstatistik (das sogenannte Hellfeld) und Befragungsstudien, in denen Jugendliche selbst berichten, ob sie eine Straftat begangen haben (das sogenannte Dunkelfeld). Beide zeigen:
In den vergangenen 20 Jahren war die Delinquenz unter Jugendlichen stark rückläufig, sowohl bei leichten Vergehen als auch bei Gewaltdelikten. Letztere haben sich unter Jugendlichen zwischen Mitte der 2000er und Mitte der 2010er mehr als halbiert: 2007 lag der Anteil von Jugendlichen, die wegen eines Gewaltdelikts von der Polizei registriert wurden, bei 1,09 Prozent, 2015 waren es 0,49 Prozent. Walburg zufolge ist das eine bemerkenswerte Entwicklung. Gründe seien, dass es mehr Präventionsprogramme an Schulen gibt, gewaltsame Erziehung zurückgegangen ist und weniger Jugendliche arbeitslos sind.
Seit 2016 ist der Polizeilichen Kriminalstatistik zufolge die Jugenddelinquenz wieder angestiegen und auch die Akzeptanz von Gewalt unter Jugendlichen hat zugenommen. Einen kurzen Einbruch gab es während der Corona-Pandemie, als es wegen der Kontaktbeschränkungen weniger Gelegenheiten für Taten gab. Jetzt werden Taten wohl teilweise "nachgeholt" und die Belastungen durch Kontaktbeschränkungen während der Pandemie schlagen sich nieder. Aber auch zunehmende ökonomische Probleme und fehlende Ressourcen in Familien dürften Walburg zufolge dafür sorgen, dass die Kriminalität aktuell wieder zunimmt.
Gründe: Freundeskreise und familiäre & ökonomische Bedingungen
Jugendliche, die Straftaten begehen, lehnen Gewalt weniger ab. Männliche Jugendliche begehen deutlich häufiger Strataten als weibliche. Oft haben sie ein Männlichkeitsbild, wonach ein Mann sich durch Stärke beweisen muss. Eine zentrale Rolle spielen die Freundeskreise, die gemeinsamen Nervenkitzel und die Anerkennung in der Gruppe suchen. All das wird begünstigt durch die familiäre und ökonomische Situation:
-
Eine wenig zugewandte oder gar gewaltsame Erziehung , fehlende Zuwendung oder Vernachlässigung spielt eine wichtige Rolle.
-
Eltern aus benachteiligten Verhältnissen kann es wegen fehlender Ressourcen schwerer fallen, ihre Kinder zu fördern und zu beaufsichtigen. Fehlende soziale Teilhabe kann wiederum die Bindung an die Gesellschaft schwächen.
-
Es kann eine Rolle spielen, ob Kinder in benachteiligten Stadtteilen aufwachsen, etwa wegen fehlender Freizeitmöglichkeiten. Der Effekt auf Delinquenz ist aber nicht so stark wie etwa in den USA.
-
Mit dem sozialen Status sind oft Bildungsnachteile verbunden: Wenn Kinder seltener Anerkennung in der Schule erfahren und schlechtere Perspektiven nach der Schule haben, kann das kriminelles Verhalten begünstigen.
Kein ursächlicher Zusammenhang zwischen Kriminalität und Migration
Wenn es um kriminelle Jugendliche geht, spielt in Diskussionen schnell die Herkunft eine Rolle. Ein Blick auf die Statistik zeigt:
-
Die bundesweite Polizeistatistik gibt keinen Aufschluss darüber, ob Jugendliche mit Migrationshintergrund mehr Straftaten begehen oder nicht. Der Migrationshintergrund wird nicht erfasst, nur die Staatsangehörigkeit. Aber auch da kann die Statistik verzerrt sein, denn es sind etwa auch Straftaten enthalten, die ausländische Tourist*innen begehen. Zudem zeigen Studien, dass Personen, die als "fremd" wahrgenommen werden, häufiger von der Polizei kontrolliert und auch häufiger angezeigt werden. Was zu sehen ist: Unter allen deutschen Jugendlichen ist der Anteil der Tatverdächtigen deutlich zurückgegangen. Zugleich waren unter den deutschen Jugendlichen immer mehr Personen mit Migrationshintergrund.
-
Mehr Aufschluss geben Befragungsstudien , etwa die jüngste von 2019, die auch Erkenntnissen aus älteren Studien entspricht: Jugendliche mit Migrationshintergrund (erste und zweite Generation) berichten nicht oder kaum häufiger davon, leichtere Delikte begangen zu haben. Bei selbstberichteter Gewalt liegt die Rate über der von Personen ohne Migrationshintergrund: 11 im Vergleich zu 6 Prozent.
Walburg warnt vor pauschalen Urteilen: Jugendliche mit Migrationshintergrund sind eine sehr diverse Gruppe, mit unterschiedlichen Lebensrealitäten und Erfahrungen. Die kriminologische Forschung sei sich einig: Eine eigene oder familiäre Migrationserfahrung ist keine direkte oder gar zentrale Ursache für Delinquenz. Jugendliche mit Migrationshintergrund sind häufiger von den ungünstigen Bedingungen betroffen: Die Armutsgefährdung unter 15- bis 17 Jährigen liegt fast dreimal so hoch wie unter Personen ohne Migrationshintergrund (2021: 13,8 zu 37,4 Prozent); selbst zugewanderte Personen haben deutlich häufiger keinen Schulabschluss. Zudem zeigen Befragungsstudien, dass sie häufiger Gewalterfahrungen machen.
Eine Rolle spielen auch Diskriminierungserfahrungen , die Jugendliche mit Migrationshintergrund häufiger machen: Diese können dazu führen, dass sie sich weniger zugehörig fühlen und gewissen Normen weniger beachten. Besonders belastend können die Umstände bei jungen Geflüchteten sein: gerade wenn sie ohne ihre Familie in Deutschland sind, in Gemeinschaftsunterkünften ohne Rückzugsmöglichkeit leben und eine schlechte Perspektive auf einen Aufenthalt haben.
Was steckt hinter Krawallen?
Ausschreitungen und Krawalle, wie die an Silvester 2022/2023, sind Walburg zufolge nicht neu und finden immer wieder statt – so bei Fußballspielen, dem G20-Gipfel, der Kölner Silvesternacht oder wie kürzlich in Frankreich nach Tötung eines Jugendlichen durch die Polizei. Manche sind klarer politischer Protest, andere weniger.
-
Die Ursachen seinen die gleichen wie bei anderen Delikten. Zudem spielen soziale Ausgrenzung oder etwa Einschränkungen wie während der Corona-Pandemie eine Rolle.
-
Die Ausschreitungen selbst ergeben sich aber aus der Situation heraus: Bei Krawallen entstehen Gruppendynamiken, die Teilnehmenden schaukeln sich gegenseitig auf . Dass es spontane Dynamiken sind, zeigt sich etwa in Stuttgart: Viele Beteiligte waren vorher nicht mit Straftaten aufgefallen.
-
Auslöser sind häufig Begegnungen mit der Polizei – die wird dann zu einem gemeinsamen Feindbild.
Neben dem Event-Charakter dürfte in Berlin eine Rolle gespielt haben, dass sich viele Beteiligte von der Gesellschaft, Staat und Polizei ausgeschlossen und marginalisiert fühlen. Dass viele Jugendliche mit Einwanderungsgeschichte an den Krawallen beteiligt waren, sei aber kaum verwunderlich: In Stuttgart liegt der Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund bei rund 60 Prozent, in Berlin Mitte 2023 bei 55 Prozent.
Für die Prävention ist es dem Kriminologen zufolge wichtig, sozialräumliche Spaltungen zu verhindern und schulische sowie berufliche Perspektiven zu schaffen. Auch wichtig sei eine gut ausgestattete Jugendsozialarbeit sowie eine faire Polizeiarbeit. Gerade bei geflüchteten Kindern und Jugendlichen sei es zentral, sie zu unterstützen und zu fördern. Viele Stellen stehen aktuell vor gekürzten Ressourcen und Personalmangel, Investitionen seien hier aber besonders wichtig.
Von Andrea Pürckhauer