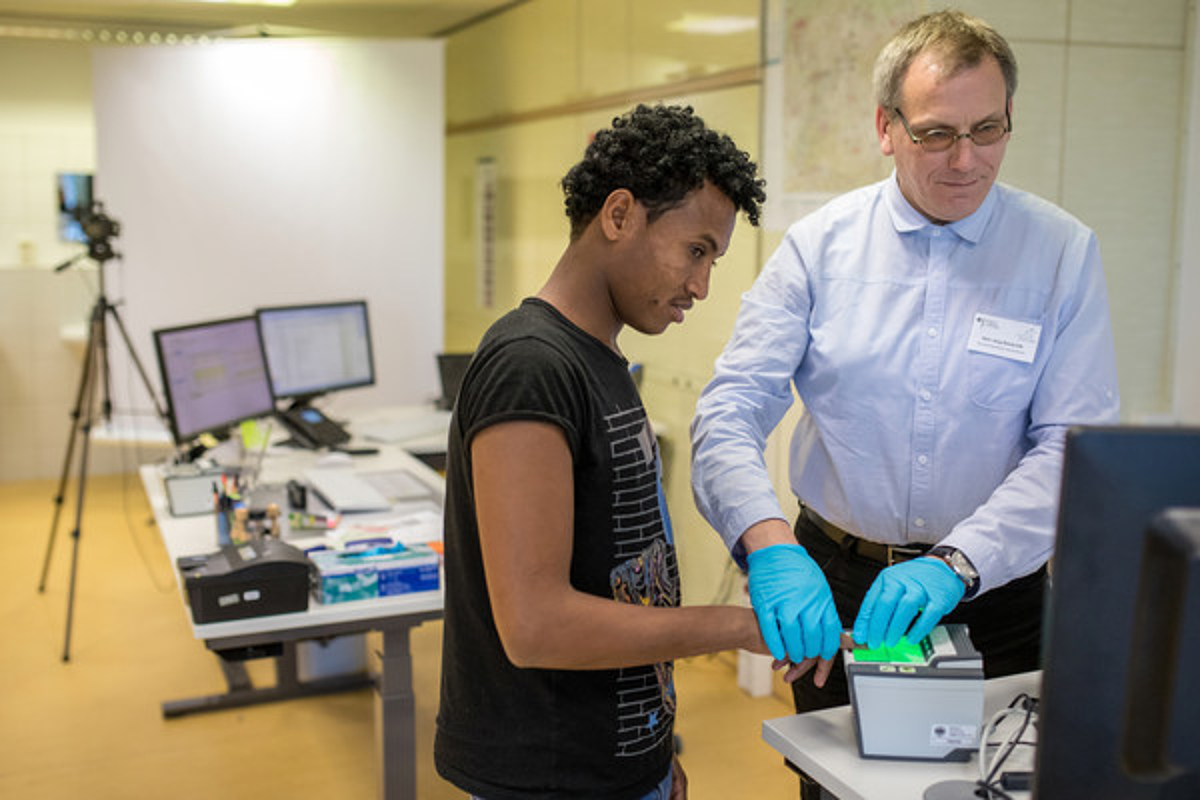MEDIENDIENST INTEGRATION: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge steht in der Kritik: Eine unbekannte Zahl an Asylverfahren soll unrechtmäßig bearbeitet worden sein. In fast allen Medien spricht man von einem „BAMF-Skandal“. Ist die Aufregung berechtigt?
Werner Schiffauer: Zunächst einmal ist sehr wenig über die aktuelle Sachlage bekannt. Wir wissen, dass das Bundesamt schon vor einigen Jahren über mutmaßliche Missstände in der Bremer Außenstelle informiert wurde. Diese Außenstelle soll mehrere Asylverfahren von anderen Bundesländern übernommen haben. Dabei soll es sich vor allem um sogenannte „Dublin-Fälle“ und um Asylanträge irakischer Jesiden gehandelt haben. Die Anwälte der ehemaligen Leiterin Ulrike B. beteuern, dies sei mit Wissen der BAMF-Zentrale geschehen. Derzeit werden mehrere Tausend Asylbescheide bundesweit überprüft. Viel mehr wissen wir nicht. Deshalb stellt sich die Frage: Was ist genau der Skandal? Dass eine BAMF-Mitarbeiterin ihren Ermessensspielraum missbraucht haben soll? Oder hat sie nur die sehr umstrittene Dublin-Verordnung nicht konsequent angewendet? Ich finde: Die Komplexität der Lage erlaubt keine vorschnellen Urteile.
Ist die Kritik am BAMF nicht zum Teil berechtigt?
Wir vom Rat für Migration haben uns in der Vergangenheit wiederholt sehr kritisch mit dem BAMF auseinandergesetzt. Der Punkt ist heute aber: Vieles war absehbar. Seit 2015 legte die Bundesregierung viel Wert darauf, das Asylverfahren zu beschleunigen. Einer der ersten Schritte nach dem „Flüchtlingssommer“ 2015 war es, ein „Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz“ zu verabschieden. Die Maßnahmen, die der damalige BAMF-Chef Frank-Jürgen Weise einführte, sollten dazu dienen, die Verfahren möglichst schnell abzuarbeiten. Dass die Sorgfalt und Genauigkeit der Entscheidungen möglicherweise darunter leiden würde, war den meisten Beteiligten bewusst. Bis auf wenige Wissenschaftler und Menschenrechts-Aktivisten äußerte sich niemand kritisch darüber.

Prof. Dr. WERNER SCHIFFAUER ist Senior Scholar am Lehrstuhl für Vergleichende Kultur- und Sozialanthropologie an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). Er forscht zum Thema Islam und Muslime in Deutschland und ist Mitglied des Rats für Migration (RfM). Kürzlich hat er zwei Studien zu Flüchtlingsprojekten in Deutschland veröffentlicht.
Wie erklären Sie sich, dass die Debatte um das BAMF so zugespitzt ist?
Ich sehe in diesem „Skandal“ ein Beispiel für das, was Soziologen „Moral Panic“ nennen: Einzelne Vorfälle werden plötzlich als Signal eines größeren, besorgniserregenden Phänomens angesehen. Dadurch werden sie plötzlich zu Medienereignissen. In anderen Worten: Die Medien berichten über einen Vorfall, Politiker liefern dazu O-Töne, die dann von anderen Medien zitiert werden und zu neuen Stellungnahmen von Politikern führen. Medien und Politik sind somit beide in einer Eskalationsspirale gefangen: Die einen müssen über die Debatte berichten, weil sie einen hohen Nachrichtenwert hat und viel Aufmerksamkeit erzeugt. Die anderen fühlen sich hingegen verpflichtet, Stellung zu einem wichtigen sozialpolitischen Thema zu beziehen. Komplexe Sachlagen werden dabei holzschnittartig verkürzt. Bezeichnend ist ein Grundtenor der Empörung.
Aber Medien müssen Probleme ansprechen können.
Ja. Die Frage ist nur, wie. In der Debatte über das BAMF werden sehr oft Metaphern verwendet, die mit Krankheiten oder körperlichen Beschwerden zu tun haben. Das sorgt wiederum für irrationale Ängste. So ist zum Beispiel die Rede von einem „Systemversagen“, das gleich an ein „Organversagen“ denken lässt. In dieser Metapher haben die Bundesbehörden die Funktion eines Immunsystems, das den gesellschaftlichen Körper vor Angriffen von Außen schützen muss. Einwanderer werden durch diese Metapher zu Fremdkörpern, die man fernhalten muss.
Könnte ein Untersuchungsausschuss helfen, die Dimensionen des Phänomens besser zu verstehen?
Das bezweifele ich. Denn sehr wenige Ausschüsse haben bislang neue Erkenntnisse über sozialpolitisch relevante Sachlagen gebracht. Die Gefahr ist hingegen, dass der Ausschuss von den Befürwortern einer strengen Asylpolitik als Bühne für ihre politische Agenda genutzt wird. Auch ist auffällig, dass es Rufe nach einem Untersuchungsausschuss gibt, weil angeblich zu viele Menschen Schutz in Deutschland bekommen. An zu Unrecht ausgestellten negativen Asylbescheiden scheint sich hingegen niemand zu stören: Wir haben nicht die gleiche Welle der Empörung erlebt, als zwölf Wohlfahrtsverbände, Anwalts- und Richtervereinigungen sowie Menschenrechtsorganisationen im Dezember 2016 die Missstände im Asylverfahren kritisierten. Es gibt aber eine weitere, noch größere Gefahr: Die Debatte hat den Druck auf die BAMF-Entscheider deutlich erhöht. Sollte die Schutzquote in einer Außenstelle plötzlich zu hoch scheinen, wird gleich der Verdacht entstehen, dass es hier auch Unregelmäßigkeiten gibt. Unter diesen Bedingungen ist zu erwarten, dass der Anteil der positiven Bescheide weiter zurückgehen wird.
Interview: Fabio Ghelli
Sie sind Journalist*in und haben weitere Fragen oder suchen Fachleute zum Thema? Dann können Sie uns gern kontaktieren. Wir helfen schnell und unkompliziert. Unsere Texte und Grafiken können kostenfrei unter den Regeln der Creative Commons und unserer Namensnennung verwendet werden. Dies gilt nicht für Bilder und Fotos, die wir von Dritten erworben haben.